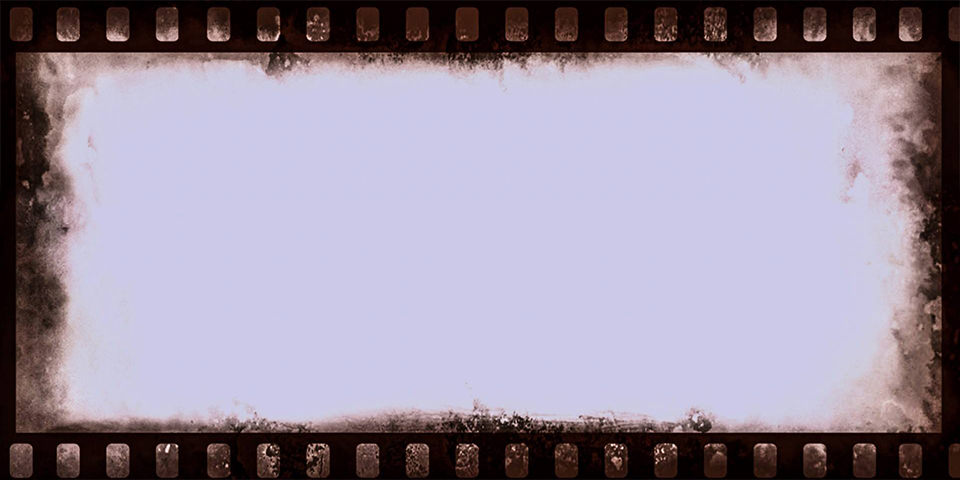Überwindung
Das da oben ist ein Platzhalter für ein Foto, das in etwa so aussieht: Entstanden an einem Sonntag im Mauerpark in Berlin, die Sonne verschwindet gerade hinter den Hochhäusern, der Himmel ist nahezu wolkenlos, die goldene Stunde ist in vollem Gange. Sie, ich schätze sie auf 23 Jahre, vielleicht 1,65 m groß, so genau weiß ich das nicht, denn sie sitzt auf einer der Bänke am Hang, direkt gegenüber der Mauer.
Ihre braunen Dreads versteckt sie halbwegs gut unter einer roten Strickmütze, sie hat schmale Augen, Piercings in der Nase und der Unterlippe. Sie trägt eine grüne Filzjacke, ihre Hände sind durch Stulpen vor der Kälte geschützt. Eine braune Hose – ich glaube, es war eine Hose – auf ihren übereinandergeschlagenen Beinen liegt ein Buch, aufgeschlagen, auf Französisch. Man sieht sie etwa zwischen Portrait und Profil, ihr Gesicht ist durch die Sonne in ein leicht goldenes Licht getaucht.
Sie bläst den Rauch der selbstgedrehten Zigarette in die kalte Winterluft, während sie gedankenverloren, vielleicht aber auch nachdenklich in die Ferne schaut. Ihr Deutsch ist nicht gut, sie erzählt mir auf Englisch, dass sie es eigentlich nicht mag, fotografiert zu werden, ihr aber meine Kamera – eine alte Hasselblad – gefällt. Das Foto ist quadratisch, trotzdem ist sie auf der Aufnahme leicht rechts zu sehen, ihr Blick geht nach links, sozusagen in die Aufnahme hinein.
Es ist das vermutlich beste Foto, das ausdrucksstärkste, das technisch einwandfreiste von den zwölf, die ich an diesem Tag machte. Zehn sind Portraits, ähnlich wie dieses, auf dem elften sieht man einen Hang, auf dem Kinder gerade Schlitten fahren und eines ist verhunzt, da ich aus Versehen auf den Auslöser drückte. Ich würde sie Euch gern zeigen, aber sie existieren nicht.
Es war ein Experiment. Der Farbfilm, ein Kodak irgendwas mit ASA 125, lief bereits 1991 ab. Er hätte irgendwelche interessanten Farben produzieren können, vielleicht auch völlig ausgebleichte oder irgendetwas mit Farbstich, aber eben auch gar nichts. Das ist das kleine Restrisiko bei so alten Filmen. Er schlummerte die ganze Zeit in einer Schublade in einem warmen Zimmer oder anders gesagt: Er wurde unsachgemäß gelagert und ist über den langen Zeitraum einfach kaputt gegangen. Auf dem Filmstreifen ist nichts. Aber das ist egal.
Ich fotografiere jetzt seit etwa 14 Monaten, habe in der Zeit einiges ausprobiert, war an Orten, die ich sonst vermutlich nie gesehen hätte. Habe mein Auge für die Welt da draußen ein bisschen geschärft – denke ich jedenfalls – da kleinere Details schneller auffallen. Ich habe Architektur fotografiert, Verfall, habe versucht, den Eindruck, das Gefühl der Orte festzuhalten, an denen ich mich befand. Habe mich in der Makrofotografie probiert, fand es nur bedingt spannend. An Straßenfotografie, Menschen auf der Straße, dem Leben. Das einzige, was ich in der all der Zeit nie getan habe, war, Menschen nach einem Foto zu fragen. Weil ich Angst hatte.
Ich habe Fotos von Menschen auf der Straße gemacht und sie danach gefragt, ob es okay ist. Was ja fast noch blöder ist, schließlich gebe ich ihnen damit ja nicht einmal die Chance, im Vorfeld nein zu sagen. Es gab diejenigen, die das Foto gelöscht haben wollten, klar, aber wirklich unfreundlich, sauer oder gar aggressiv ist nie jemand gewesen. Ich halte das für keine Selbstverständlichkeit, aber das nur am Rande.
Jedenfalls habe ich mich nie getraut, Menschen einfach so zu fragen. Das hat zwei Gründe: zum einen ein ordentlicher Knacks in meinem Selbstbewusstsein, das ich mir sowieso erst ziemlich spät angeeignet habe. Zum anderen habe ich immer wieder die Szene auf der Photokina 2010 im Kopf, bei der diese Traube von Fotografen sich gegenseitig wortwörtlich über den Haufen rannte, um noch ein Foto vom Bodypainting-Modell zu bekommen, das gerade von der Bühne zur Garderobe ging, da die Show längst vorbei war. Eine Szene, die mich angeekelt hat und mit der ich niemals verglichen werden möchte.
Der Mauerpark in Berlin also. Ich dachte mir, mit all den sagen wir mal aufgeschlosseneren Menschen in meinem Alter dort sollte es doch möglich sein, nicht sofort schräg angeschaut zu werden. Ich hatte die Hasselblad in der Hand, die digitale Nikon ist ja schon etwas wuchtig und könnte vielleicht etwas abschreckend wirken. Ich lief hin und her, lief Runden, suchte nach ausdrucksstarken Gesichtern. Fand sie. Wollte mir einen Ruck geben. Tat es nicht. Verfluchte mich eine Sekunde später dafür. Lief weiter.
Auf der eingeschneiten Wiese dann das asiatische Pärchen entdeckt, sie fotografiert gerade ihn. Warum eigentlich nicht, Menschen, die selbst fotografieren, dürften ja noch einmal eine Ecke aufgeschlossener sein. Ich wartete, bis sie ihre Fotos gemacht hatte. Adrenalin, Puls durch die Decke, Herzrasen, alles zusammen, während ich auf sie zuging. Ob ich ein Foto von ihm machen dürfte? Sie verstanden mich nicht. Okay, Englisch, schnell die richtigen Worte zusammenlegen, noch einmal fragen, dabei verhaspeln, verdammt, das war’s jetzt bestimmt.
Ja, klar, was soll ich tun? Oh, wow, so weit war ich gar nicht. Ich wollte nichts Gestelltes, das war das Einzige. Um ihn abzulenken, unterhielt ich mich ein bisschen mit ihm, woher sie denn kämen (USA, Nähe Washington), ob sie auf dem Flohmarkt gewesen wären („Yeah!“), wie sie es fanden („kinda cool, but too crowded“) und drückte den Auslöser. Fertig. Kurz sacken lassen, wirklich fertig. Ich gab ihnen meine Karte, damit sie mich kontaktieren können, falls sie das Foto haben möchten. Sie lächelten, wir sagten tschüss und gingen unserer Wege. Das war’s. Adrenalin geht runter, Puls kommt langsam wieder in normale Bereiche. Wow.
Mit jedem Foto wurde es einfacher. Ich war jedes Mal aufgeregt, aber es wurde einfacher. Die meisten fanden die Kamera interessant, den Lichtschachtsucher, wofür ich überhaupt Fotos mache, manche schauten skeptisch, warum gerade sie, man kommt irgendwie in ein kurzes Gespräch. Zwei sagten direkt nein, aber es war okay. Sie wollten einfach nur nicht fotografiert werden, es ging nicht um mich und es war okay. Rein von der Komposition her war wahrscheinlich keine der Aufnahmen besonders gut, aber auch das war okay.
Und es begann, Spaß zu machen. Die Filmentwicklung am Tag danach dauerte nur ein paar Stunden. Der Mitarbeiter im Labor zeigte mir einen völlig transparenten Filmstreifen. Ob meine Kamera kaputt sei, fragte er mich. Nee, antwortete ich lächelnd, um meine Enttäuschung zu überspielen, die aber nur für ein paar Sekunden anhielt.
Denn es ist egal. Es ist egal, dass auf den Negativen nichts zu sehen ist, die Fotos existieren einfach in meinem Kopf weiter. Es ist egal, denn sie stehen für etwas viel Besseres, einen Schritt, den ich getan habe, und der mich viel Überwindung gekostet hat. Dieses Mal war nicht das Ergebnis das Ergebnis. Und das macht sie zu den besten Fotos der vergangenen Wochen, auch wenn es sie gar nicht gibt.
Ob er den Filmstreifen wegschmeißen soll, fragte er. Nein, ich möchte ihn behalten.
Dieser Text ist bereits von 2010 und wurde erstmals auf dem alten Blog von Christoph veröffentlicht. Er hat ihn nun in Erinnerung daran auf seine Facebookseite gestellt. Wir veröffentlichen ihn mit Genehmigung. Das Titelbild ist ein Platzhalter und nicht das Originalnegativ.