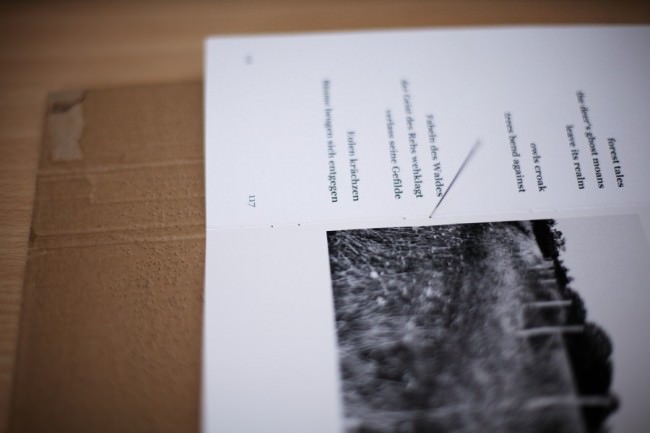Von der Idee zum Fotobuch
Von meinem selbstgemachten Fotobuch „still“ haben wir im Dezember schon ein Exemplar im Adventskalender verlost. Seitdem habe ich noch einige weitere gedruckt, gebunden, verschickt und während dieser meditativen Handarbeiten meine Gedanken kreisen lassen.
Dabei habe ich nicht nur den Ablauf der Buchherstellung und die Qualität der einzelnen Bücher verbessern können, sondern mir ist im Nachhinein auch klar geworden, wie spannend auch die Entstehung des finalen Buchkonzeptes war. In beides – Konzeptentwicklung und Buchherstellung – möchte ich Euch nun Einblicke gewähren, die von Fotos des handwerklichen Prozesses illustriert werden.
Der Plan
Irgendwann im Juli letzten Jahres kam (zugegebenenermaßen nicht zum ersten Mal) die Idee auf, aus meinen eigenen Fotos ein Buch zu machen. Andere machen Abzüge der eigenen Bilder, kleben sie in Alben oder hängen sie sich an die Wand. Ich wollte meine Bilder auch einmal besonders hervorheben, aber nicht nur für mich, sondern für die Menschen, die sie besonders mögen.
Eine Erwähnung von Marit zum Thema Buchbinden gab mir den entscheidenden Anstoß und ich begann, im allwissenden Internet Anleitungen zu verschiedenen Buchbindetechniken zu lesen. Ein paar auch für mich Laien machbare schienen dabei zu sein, also ging ich in meiner Euphorie direkt die nächste große Baustelle des Projektes an: Den Druck.
Da ich ganz generell lieber so viel wie möglich selbst mache, anstatt nur irgendwo einen schnöden Druckauftrag abzuschicken, zog ich verschieden starke Papiersorten, die ich gerade zur Hand hatte, durch meinen Drucker, der zu diesen ersten Testzwecken von mir veranlasst ein paar meiner eigenen Lieblingsbilder ausspuckte.
An diesem Punkt ist mein Hang zum Selbermachen der wichtigste Formgeber des bis dato inhaltlich völlig offenen Buchprojektes geworden. Denn: Wenn ich das Buch selbst machen wollte, würde es sich nach den Möglichkeiten meines Druckers richten. Ausgangspapierformat also am einfachsten A4 und von einer Sorte, die sich leicht im Einzelhandel beziehen ließe.
Beim Anblick der gedruckten Testbilder wurde auch ganz schnell klar, dass die Druckqualität der Farbbilder nicht ausreichend war. Ich hätte nun anfangen können, mich mit der Kalibrierung von Druckern zu beschäftigen, aber diese Möglichkeit zog ich nicht ernsthaft in Erwägung, da die Schwarzweißbilder absolut hervorragend aussahen.
Damit stand bereits der Fundus fest, aus dem ich schöpfen würde: Meine analogen Schwarzweißbilder. Entgegen dem, was ich die meiste Zeit präsentiere, also so gut wie keine Portraits. Eine gute Gelegenheit, wenig beachteten Bildern noch einmal eine neue Öffentlichkeit zu schenken.
Als ich alle in Frage kommenden Bilder sichtete, wurde mir schnell klar, dass das Buchformat – hoch oder quer – eine schwere Entscheidung sein würde. Ich blätterte durch ein paar Fotobände und stellte fest, dass bei genauer Betrachtung alle furchtbar waren: Hochformate müssen damit leben, immer nur halb so groß zu sein wie Querformate, die mit einem hässlichen Falz in der Mitte verunstaltet sind – bisher war mir das nie aufgefallen.
Über diese Unzulänglichkeiten hätte ich mich ärgern können. Tat ich aber nicht, da ich kein fantastisches Wunschprojekt im Kopf hatte, von dem sie mich abbrachten. Sogar ganz im Gegenteil: Ich empfand es als sehr angenehm, durch Einschränkungen der Technik und eigene Ideale zu Form und Inhalt geleitet zu werden, die sich so Stück für Stück fast von selbst ergaben.
So war klar: Die Seiten müssten quadratisch sein, damit ich Hoch- und Querformate jeweils in der gleichen Bildgröße einseitig präsentieren kann. An diese Notwendigkeit musste ich mich erst gewöhnen, da ich quadratische Bücher bisher immer mit den unsäglichen Sprüche- und Geschenk-Büchern für einfallslose Menschen, die in der letzten Minute etwas Billiges für den Geburtstag von Tante Klara suchen, in Verbindung gebracht hatte.
Für quadratische Seiten hätte ich nun entweder große Papierbögen druckergerecht teilen oder von A4-Blättern etwas abschneiden müssen. Die eine Möglichkeit wäre zu viel Schneiderei gewesen, die andere hätte ein zu kleines Endformat zur Folge gehabt. So entstanden die halben Seiten.
Halbe Seiten? Genau. Ich ließ den zum 2:1-Format fehlenden Teil der A4-Blätter einfach weg, um ohne Schneiden die ganzen, normalen Blätter benutzen zu können. Daraus ergaben sich aber wiederum zwei Dinge:
1. Würde man beim Betrachten eines Bildes immer auf der gegenüberliegenden Seite ein halbes anderes Bild sehen.
2. Mussten die halben Seiten zwingend mit Text gefüllt werden, damit sie nicht nur als faule Rudimente mit an Bord sind.
Für das erste Problem hatte ich schnell eine Lösung, inspiriert von alten Fotoalben und ihrem Spinnenpapier: Ich kann zwischen zwei Blätter jeweils Transparentpapier mit ins Buch binden, sodass die gegenüberliegenden Bildseiten stärker verdeckt werden, aber die Bilder noch blass durchschimmern.
Leider löste diese Konstruktion in meinem Kopf eine euphorisch-kreative Kaskade aus: Den Bildern kann ich so etwas wie Gedichte an die Seite stellen, die mit der Halbdurchsichtigkeit des Transparentpapiers spielen, indem sie teilweise auf das Transparentpapier und teilweise auf das normale Papier darunter gedruckt werden. Zwei Gedichte, die übereinander gelegt ein neues ergeben.
Puh. Eine Idee, die so starre formale Vorgaben macht, dass die Qualität der Texte sicherlich leiden wird, da ich ja auch kein erfahrener Poet bin. Zum Glück musste ich mich daran nicht versuchen, da mein Drucker die Idee vereitelte: Die Blätter des Transparentpapiers waren mit insgesamt knapp 80 cm Länge zu lang für ihn.
So musste ich „nur“ noch für die knapp 80 Bilder, auf die ich mich mit mir selbst nach wochenlangem Aussieben, Erweitern, Verwerfen, Sortieren und Wiederneuanordnen geeinigt hatte, jeweils ein paar Worte finden. Nach den ersten niedergeschriebenen Textfragmenten fand sich dafür schnell ein Rhythmus von jeweils drei plus zwei kurzen Zeilen.
Beim Aneinanderreihen der ausgewählten Bilder schaute ich automatisch auf Gemeinsamkeiten, Gegensätze, Assoziationen und hatte schnell so etwas wie eine abstrakte Geschichte im Kopf, die mich von einem zum anderen Bild leitete, Übergänge schuf. Aus diesen Erinnerungen, Gefühlen und den im Laufe der Jahre vergebenen Bildtiteln tippte ich innerhalb von zwei Tagen meine Texte – nachts und mit etwas Rotwein: Meinen persönlich optimalen Rahmenbedingungen für freie Gedankenassoziationsketten.
Da meine Bildtitel normalerweise Englisch sind, der größte Teil des zu erwartenden Publikums – aber wer weiß! – allerdings deutschsprachig, stand auch schnell fest, dass die Ausgabe zweisprachig werden würde. Eine neue Herausforderung, die gleichzeitig aber auch vielen der Textfragmente ihre Form gab, wenn ich eine der beiden Versionen verändern musste, um mit dem vorhandenen Platz auszukommen.
Das Layout der einzelnen Seiten war schnell gefunden: Die Bilder so groß wie möglich, aber mangels formatfüllendem Druck mit so viel Abstand zu den Rändern, dass der bei jedem Blatt etwas anders ausfallende Papiereinzug des Druckers nicht unangenehm auffallen würde oder im abschließenden Beschnitt des Buchblocks korrigierbar wäre.
Beim wunderbaren Buch „The Moon Is For Adults Only“ von Laura Makabresku hatte ich mich ein paar Wochen zuvor in den Umschlag verliebt, der ein gefaltetes Poster ist. Das wollte ich auch haben. Bekam ich dann auch, nachdem ich im Spätherbst mehrere Wochen lang verzweifelt nach einer erschwinglichen, aber qualitativen Möglichkeit suchte, mein Umschlagbild 30 mal in A2 – Papier nicht zu dünn, nicht zu dick – drucken zu lassen.
Die Umsetzung
Dass ich mir bei der Wahl meines Formates gedacht hatte, dass das Zuschneiden von Papier ins Format 2:1 zu viel Schneiderei wäre, ließ mich nun über mich selbst lachen, als endlich alles vorbereitet war und ich zusammentrug, was für ein einzelnes Exemplar alles zu tun war:
- 20 Blätter Transparentpapier zuschneiden (von der Rolle, 20 x 0,66 m)
- Buchinhalt drucken, 40 Blatt doppelseitig
- Transparent- und Normalpapier falzen
- Alle Blätter für die Bindung lochen
- Den Buchblock binden
- Buchrücken verleimen, trocknen lassen
- Buchblock ringsherum beschneiden
- Lesebändchen ankleben
- Cover ankleben
- Poster-Umschlag falten
- Nummerieren und signieren
- Halbtot in einen Sessel kippen
Die Herstellung des ersten Buches zog sich so über mehrere Tage und Nachtschichten hin. Viele Schritte machte ich zum ersten Mal, auch wenn ich sie mir in meiner Vorstellung schon genau zurechtgelegt hatte. Natürlich klappte so einiges nicht so wie gedacht, ich war kurz davor, alles hinzuwerfen und machte dann vom Ehrgeiz gepackt doch weiter.
Nachdem ich monatelang am Inhalt, also den Bildern, ihrer Reihenfolge und den Worten, die sie begleiten und hoffentlich beim Betrachter weitere Dimensionen öffnen würden, gearbeitet hatte, war ich damit rundum zufrieden, stolz darauf und energiegeladen genug, für jede Widrigkeit eine Lösung zu finden!
Inzwischen habe ich durch Routine, eine veränderte Reihenfolge und teilweise gleichzeitiges Erledigen von mehreren Arbeitsschritten die Arbeitszeit pro Exemplar auf etwa die Hälfte reduziert. Das sind zwar immer noch etwa zehn Stunden, aber es ist jedes Mal ein überwältigendes Gefühl, ein fertiges Buch in der Hand zu halten. Es zu wiegen.
Der Prozess beginnt damit, das Transparentpapier von der Rolle in knapp 80 cm lange Bahnen zu schneiden. Gar nicht so einfach, dabei keine Flecken oder Knicke zu verursachen und überall rechte Winkel zu erhalten, damit nicht alles krumm und schief wird.
Anschließend drucke ich den Buchinhalt. Jedes Blatt wird einzeln in den Drucker eingelegt, da ich beim Testen bemerkt habe, dass die manuelle Zufuhr das Blatt fast ganz gerade einzieht. Das dauert natürlich richtig lange, aber währenddessen falze ich schon einmal das Transparentpapier und die fertig bedruckten Blätter.
Danach werden alle Blätter mit einer Schablone, Nähnadel und einem Fingerhut für die sich anschließende Bindung vorgestochen. Wenn ich hier sehr ordentlich arbeite, geht die Bindung danach richtig schnell, weil ich alle drei Löcher, die in jedem Heft des Buches übereinanderliegen, mit der Nadel auf einmal finde, anstatt blind und wild im Blätterhaufen herumzustochern.
Nachdem ich mir verschiedene Möglichkeiten zur Buchbindung angesehen hatte, habe ich eine eigene Variante entwickelt, die nicht so furchtbar viel Faden verbraucht wie die meisten anderen, die den Faden am Buchrücken über die ganze Länge hoch und runter führen. Da mein Buch mit gut 2 cm sehr dick geworden ist, binde ich am Rücken vier Mal mit gewachsten, dreifachen Fäden. Fühlt sich stabil an.
Die ersten Exemplare hatte ich bereits an diesem Punkt mit Schraubzwingen zwischen zwei Platten fixiert und den Buchrücken mit Ponal verleimt, verstärkt mit Mullbinde. Den an einer Seite schon verklebten Buchblock dann noch zu beschneiden, wurde aber nicht so richtig schön und auch große Schneidemaschinen fransten die Blätter aus, da der Buchblock durch die halben Seiten nicht gleichmäßig dick ist.
Also beschneide ich inzwischen zuerst und verleime erst dann den Buchrücken. Dabei fiel meine Wahl auf Ponal, da dieser sich als Holzleim auf Wasserbasis nicht nur oberflächlich mit dem Papier verbindet und nach dem Trocknen noch eine gute Flexibilität hat. (Toll, auf welchen Spezialgebieten man lernt.) Immerhin möchte man das Buch nicht nur ins Regal stellen, sondern auch durchblättern, also den Buchrücken hin und her biegen.
Das erste Exemplar – und damit das ganze Projekt – wäre an dieser Stelle beinahe gescheitert, da ich es nach dem Leimen zu früh aus der Presse nahm und dann zusehen musste, wie der ganze Brocken sich wellte und vollkommen verzog, während ich auch noch versuchte, den ganzen Buchblock auf einmal zu schneiden.
Zum Glück war es mitten in der Nacht und ich dachte mir: Pack das Ding wieder in die Presse, schlaf erst einmal richtig aus und träum davon, dass Du morgen früh auf wundersame Weise alles noch rettest. Die Presse hat es geradegebogen und der Morgen brachte die richtige Idee, den Block stückweise zu schneiden.
Die letzten Schritte, in denen die Lesebändchen, das Cover, der Umschlag und die Nummerierung gemacht werden, sind eigentlich nur i-Tüpfelchen. Und trotzdem runden genau diese Rahmenelemente ein Buch erst so richtig ab. Vielleicht kann man diese Verwandlung aber auch nur dann erkennen, wenn man einmal erlebt hat, wie sich das mulmige, verkrampfte Gefühl im Bauch, mit dem man den nackten, verleimten Buchblock betrachtet, der einen schon Stunden des Lebens und der Feinmotorik gekostet hat, durch den letzten Schliff in vollkommen federleichten Stolz auflöst.
Wer bis hierhin gelesen hat, hegt wahrscheinlich ohnehin ein Interesse für Handwerkliches und Kurioses abseits der reinen Fotografie; fragt sich aber möglicherweise dennoch, warum ich so ausführlich meine Erfahrungen bei der Herstellung eines Buches beschreibe, anstatt ein Tutorial zur Bildbearbeitung zu schreiben.
Weil ich Euch anregen möchte, Euren Stolz auf die eigenen Bilder noch einmal um ein Vielfachtes zu steigern, indem: Ihr Euch einmal Eure eigenen Lieblingsbilder aussucht. Sie länger betrachtet als jemals zuvor, dabei Verbindungen und neue Gedanken in ihnen findet. Euch etwas wirklich Großes für diese besonderen Bilder ausdenkt. Euch an der Idee festbeißt. Sie verdammt nochmal umsetzt!
PS: Und meine private Seelenklempnerin ist natürlich ganz vernarrt in die Erweiterung der Fotos um assoziativ-lyrische Textfragmente. Tausend Mal besser als Traumdeutung. Mal sehen, wann ich meinen Artistproof wieder zurück habe…