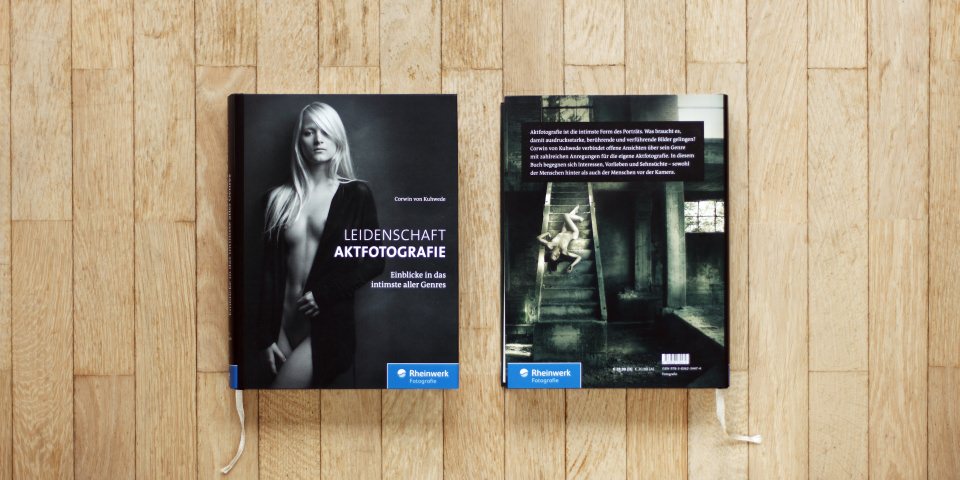Niemand ist eine Insel
„Sie mussten erkennen, dass die Werte der Welt, in der wir leben, und die Menschen, mit denen wir uns umgeben, entscheidende Auswirkungen darauf haben, wer wir sind.“ – Malcom Gladwell
Eine sehr populäre Theorie unter Fotografierenden ist, dass das zentrale Element, um das sich alles dreht, gänzlich eigene Ideen sind. Ich möchte diese Theorie in Frage stellen. Und zu Beginn sei mir ein persönlicher Einstieg erlaubt.
Ich habe jahrelang versucht, eigene Ideen zu entwickeln. Mein Ding zu machen mit der Fotografie. Bilder zu gestalten, auf die noch niemand vor mir gekommen ist. Und es fühlte sich so an: Puh, naja. Zwar hatte ich ein paar Ideen, aber mit ein bisschen Recherche wurde mir schnell klar: Martin, da war schon jemand vor Dir schlau. Na toll.
Immer wieder dachte ich daran, wie schön es doch wäre, einen Fotostil zu entwickeln, der noch nie in dieser Form dagewesen war. Etwas zu erschaffen, was keiner vorher je gedacht und auf diese Weise umgesetzt hatte.
Jedoch wurde ich immer und immer wieder enttäuscht. Denn ich merkte, dass ich nichts schaffen konnte, was nur aus mir selbst heraus entstehen konnte. Ein wenig gefrustet, ließ ich nach einer Weile die Idee vom Streben nach dem Unikum eine Weile liegen. Das wiederum fühlte sich ganz gut an.
~
Doch lassen wir mal die lieben Gefühle beiseite. Heute glaube ich nicht mehr an das Geschichtchen mit der ganz eigenen Idee. Ich halte das Bemühen darum – zumindest für mich selbst – für Zeitverschwendung. Warum?
Weil wir keine unbeeinflussbaren Individuen sind. Und das, obwohl wir in einer Gesellschaft leben, die das Individuum und seine Genialität schier vergöttert.
Wir lieben es, wenn Daniel Craig, Uma Thurman oder Bruce Willis (für die Braveheart-Freunde: Mel Gibson) gegen die Bösen kämpfen. Sie sind die Helden, ganz allein. Sie schaffen es, ganze Armeen mit ihrem Einfallsreichtum, ihrer Disziplin und ihren heldenhaften Überzeugungen in Bann zu ziehen.
Was hat das mit der Fotografie zu tun? An dieser Stelle möchte ich gern eine Ebene tiefer gehen und einen kleinen Sprung in die Philosophie wagen. Der aus aus Slowenien stammende Slavoj Žižek nennt Kino „ein pädagogisches Institut“. Wenn wir eine Gesellschaft verstehen wollen, „müssen Sie nur ihre Filme ansehen.“ Es zeige ihre Struktur in Reinform.
Diese Struktur umgibt auch uns, die der Fotografie anhängig geworden sind. Sie beeinflusst unsere Wünsche, unseren Willen und die Art und Weise, wie wir an Dinge herangehen.
Das geheimnisvolle Genie
Ein weiterer Mythos, der dem Ganzen zugrunde liegt, ist die Redewendung „vom Tellerwäscher zum Millionär“, die wir aus dem Amerikanischen importiert haben. Dahinter steckt, wie jeder weiß, die Idealvorstellung, dass es jeder Arme schaffen kann, reich zu werden – und die Medien sind voll von überbordenden Heldentaten. Und auch hier lohnt ein Blick hinter Kinokulissen und Metaphern, mit denen nicht gespielt wird.
Einer (meistens ist es ein Mann) ist glorreicher als alle anderen. Er schafft das Undenk-, das Unfassbare. Gepriesen seist Du, einzelner Mann, der Du es schafftest, was keiner auch nur zu denken wagte!
Zurück auf den Boden der Tatsachen. Von solchen Ideologien umgeben sind auch wir, die Fotografen, die wir uns nicht selten auch als Künstler identifizieren. Die Fotografie als solche hat auch diesen Zweig, diesen Strang um das geheimnisvolle Genie. Und wer will nicht ein Genie sein?
Groß, bekannt, ein Star werden. Und: Mit unserer ganz eignen Idee. Mit unserem Stil. Wir, die Helden. Applaus, Applaus. Gepriesen.. ach, lassen wir das.
Zwar würde ich nicht mit den Rekreationisten sagen, dass alles ein Remix oder – das langsam einstaubte Wort – ein Mashup ist. Ich glaube nicht, wie Austin Kleon in „Steal like an Artist“ konstatiert, dass wir „nur die Summe unserer Einflüsse“, der „Remix unserer Mütter und Väter“ wären. Im Gegenteil, ich glaube, dass Kreativität das ist, was wir aus unseren Einflüssen machen.
Aber zu glauben, dass wir aus uns heraus die allergeilsten Fotos der Welt machen werden, ist Irrsinn. Uns theoretisch von unseren Einflüssen loszusagen, wirkt kontrakorrektiv, denn in diesen leben wir und können nicht ohne sie.
Vom Vor- und Sehnsuchtsbild
Der Idee des ganz und gar Eigenen liegt auch zugrunde, dass der oder die Agierende einerseits etwas schafft, was vorher nie in dieser Form dagewesen war, andererseits aber (und vor allem) keinerlei Ähnlichkeit mit Werken anderer aufweist.
Hierzu ZEIT-Redakteur Hanno Rauterberg in seinem Artikel „Schöner Klauen“:
Das ganze System der ästhetischen Produktion, das System der Kunsthochschulen, des Kunstmarkts, der Kunstmuseen, basiert auf der Vorstellung, dass Künstler etwas zu bieten haben, was andere nicht bieten.
Dass die Künstler also doch etwas Besonderes sind, eigensinnig, eigenständig, originell. Diese Vorstellung entwickelte sich im ausgehenden 18. Jahrhundert auch aus einem antiaristokratischen Impuls heraus.
Der Adel war durch seine Abkunft legitimiert, die Künstler hingegen setzten sich über alle Traditionen hinweg, wollten Abgrenzung, nicht Nachfolge. Sie waren ihre eigenen Urheber, selbstbestimmt, aus sich selbst schöpfend. Als solche, als autonome Subjekte, konnten sie zum Vor- und Sehnsuchtsbild der Bürger avancieren.
Sie waren ihre eigenen Urheber, selbstbestimmt, aus sich selbst schöpfend. Klingt eigentlich gut. Leider zu gut, oder gar: falsch.
Evelyin Finger zitiert in ihrem Artikel Wie genial muss es denn sein? den Historiker Dirk van Laak: „Es gebe, sagt Dirk van Laak, in der modernen Gesellschaft ein irres Bedürfnis, überrascht zu werden. Dahinter würden sich Abgeklärtheit und Abgestumpftheit verbergen.“
Diesem Bedürfnis begegnen wir in Kommentarform regelmäßig. Wo? Hier, in diesem Magazin. Es ist keine Seltenheit, dass Kommentatoren enttäuscht um ihre verlorene Zeit leicht beleidigt der Redaktion vorwerfen, das hiesig gezeigte wäre nun „auch keine Neuheit“ mehr. Und wäre deshalb besser in der Tonne gelandet.
Schnarchopoparch! Gar keine noch nie dargebotene Bruce-Willis-Action! Ich will sofort mein Geld zurück!
Der Beginn
Jedoch schauen wir alle auch Fotos von anderen an und bauen auf dem auf, was Fotografen vor uns geleistet haben. Fotografen, die uns mit ihren Bildern inspirieren. Dazu bewegen, mal etwas Ähnliches zu probieren.
Das geht – zu Ende gedacht – soweit zurück bis zum Beginn, als wir unser erstes Foto machten.
Irgendetwas bewegt uns dazu, ein Bild zu machen. Vielleicht, weil es eine Familientradition ist und schon unsere Eltern fotografierten. Oder weil unsere Eltern dem Musischen nahe waren. Vielleicht auch, weil wir an der Wand der Freundin so tolle Abzüge sahen und dachten: Das will ich auch. (Das sind Beispiele, die es in eintausend Abwandlungen gibt, bitte keine wörtliche Auslegung.)
Und dann beginnen wir, zu fotografieren.
Und mit der Fotografiererei werden wir ganz – unerwartet – sensibel und empfänglich für die Werke anderer Fotografen. Schauen uns deren Bilder an, lassen uns davon inspirieren und versuchen, den Look, das Gefühl oder etwas anderes von dem, was wir da sehen, irgendwie auch in unseren Fotos zu finden.
Und merken: Wir sind umgeben von Inspirationen. Wir wollen und wir können uns davon nicht trennen.
Albert Einstein soll einmal gesagt haben: Das Geheimnis der Kreativität ist es, seine Quellen verstecken zu wissen. Womit Herr Einstein auch unterstreicht, dass jeder seine Quellen hat. Doch die wenigsten können oder wollen das zugeben. Sie sehen sich lieber im Lichte der eignen Genialität.
Jedoch: Niemand ist eine Insel.
Und selbst, wenn wir eines tun, was so ganz eigen erscheint, wenn wir von vielen Fotografen Vorgemachtes umkehren, es brechen, es umdrehen, verkrümmen oder in andere Kontexte setzen: Wir beziehen uns damit dennoch ständig auf sie.
Diametrale Inspiration
Der Familientherapeut Hellinger (er ist nicht zu Unrecht umstritten) sagte einmal „Hass bindet auch“ und erklärte an anderer Stelle, dass wir gerade dann, wenn wir sagen, wir wollten nicht so werden wie unsere Eltern, so werden wie sie. Und dass dieser Drang des „Andersseins“ immer wieder auf sie zurückführt.
Natürlich hassen wir nicht die Fotos anderer (obwohl…). Doch selbst oder insbesondere eine Abneigung gegen einen bestimmten Stil hat eine Zuneigung zu einem anderen Stil zur Folge und ist somit inspiriert von – ? Dem, was zu Beginn nicht gemocht wurde.
Zum Schluss übergebe ich das Wort nochmals an den oben zitierten Malcom Gladwell*:
Kein Eishockeystar, kein Bill Joy, kein Robert Oppenheimer und kein anderer Überflieger kann aus der Höhe seines Erfolges herabblicken und ehrlich von sich behaupten: „Das habe ich nur mir zu verdanken“.
Oberflächlich betrachtet scheinen Staranwälte, Mathematikgenies und Softwaremilliardäre einer anderen Welt anzugehören als wir. Doch das stimmt nicht. Sie sind das Produkt ihrer Geschichte, ihrer Gesellschaft sowie der Chancen, die sie hatten und der kulturellen Traditionen, die sie geerbt haben.
Ihr Erfolg hat nichts Übermenschliches oder Geheimnisvolles an sich. Er ist das Ergebnis von bestimmten Vorteilen und ererbten Traditionen, er ist zu einem Teil verdient, zu einem anderen nicht, einiges haben sie sich selbst erworben, anderes ist ihnen in den Schoß gefallen – doch all das hat entschieden dazu beigetragen, sie zu dem zu machen, was sie sind.
Die Überflieger sind am Ende eben alles andere als Überflieger.
Übrigens: Dieser Artikel wurde inspiriert von der Beschäftigung mit systemischer Familientherapie, Emergenter Theologie, einem Artikel, den ich vor einem halben Jahr gelesen und den Link (dummerweise) nicht gespeichert habe, meinem Freund Daniel Ehniss und vielen kleinen Dingen, die mich zum Nachdenken gebracht haben.
* Das ist ein Affiliate-Link zu Amazon. Wenn Ihr darüber etwas kauft, erhalten wir eine kleine Provision, Ihr zahlt aber keinen Cent mehr.