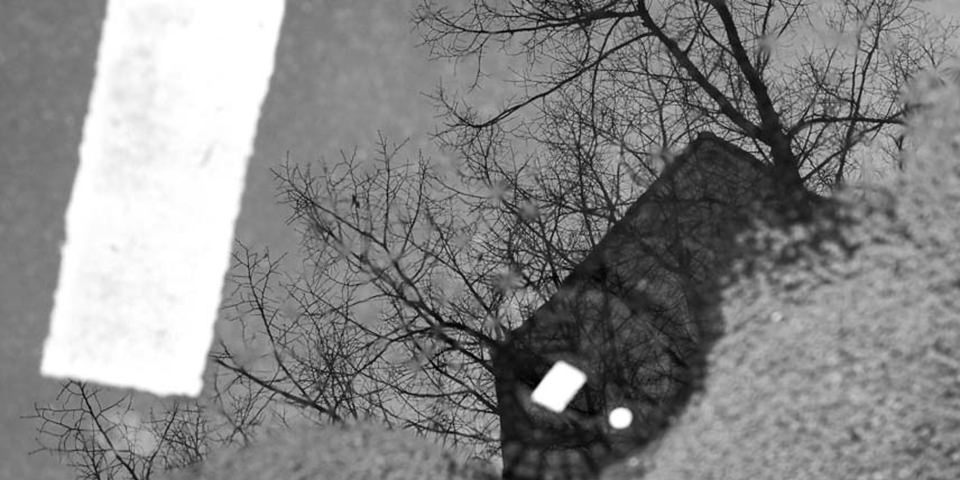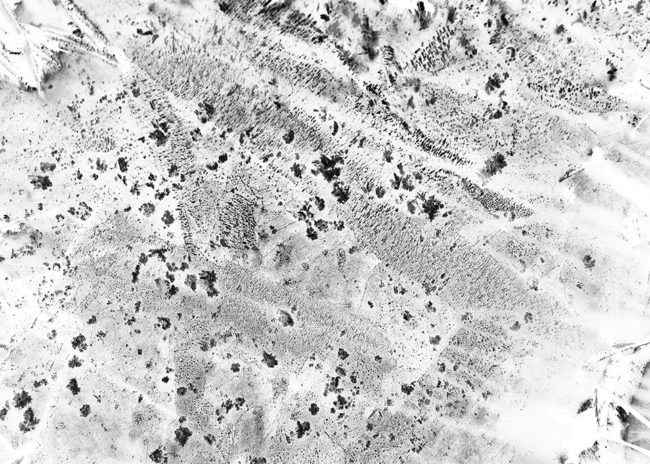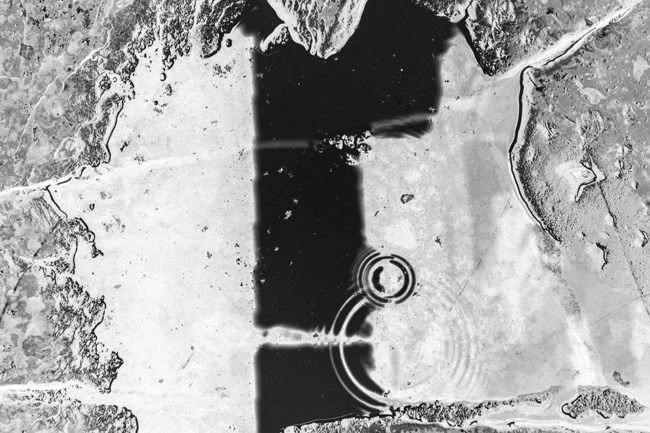Höhlenbilder
Noch nicht zu höherer Erkenntnis gelangt, hält die Menschheit sich noch immer in Platos Höhle auf und ergötzt sich – nach uralten Gewohnheiten – an bloßen Abbildern der Wahrheit. (Susan Sontag)
Das war es also, was ich vorhin als Behauptung aufstellte und durch die Erörterung mit dir zur evidenten Wahrheit bringen wollte, dass nämlich die Malerei und überhaupt die mit Nachahmung sich abgebende Kunst nicht nur weit von der Wahrheit entfernt ihr Wesen treibt, sondern auch nur mit einem gleichfalls von höherer Geistestätigkeit entfernten Vermögen in uns Verkehr hat, mit ihm buhlt und liebelt zu einem Endzwecke, der durchaus kein solider, kein wahrer ist. (Platon)
Die Frage nach dem Wesen des fotografischen Bildes ist so alt wie die Fotografie selbst. Und die Frage ist nach dem Verhältnis von Abbild und Wirklichkeit sogar noch wesentlich älter. Sie führt zurück bis zu Platon, dessen Höhlengleichnis gleichermaßen zum Diskurs über grundlegende philosophische Erkenntnisfragen einlädt wie auch zur Begründung einer ersten Bildtheorie.
Darüber hinaus geht es um das moralische Urteil. Kann das künstlerische Bild einen positiven Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung und zur sozialen Befriedung leisten? Platon verneinte dies. Nachbildende Kunst und Moral haben nichts miteinander zu tun. Kunst vermag lediglich niedere Instinkte anzusprechen, höhere geistige Reflexionsprozesse werden durch sie nicht befördert. Aber schon sein Schüler Aristoteles sah dies entschieden anders, indem er auf das kathartische Potential hinwies. Dramatische Bühnenszenen können, so seine Überzeugung, Konflikte darstellen und gleichzeitig Lösungsansätze offerieren, um so das Verhaltensrepertoire des Betrachters im Sinne einer charakterlichen Entwicklung zu erweitern.
Kann Fotografie wahr sein und zur Schaffung einer besseren Welt beitragen? Oder handelt es sich bei ihr um ein Schein- und Showgeschäft ohne ethische Relevanz? In der Geschichte der Fotografie und ihrer Rezeption zeigt sich, dass die erkenntnistheoretischen und ethischen Fragestellungen der Antike weiterhin Bestand haben. So eröffnet die amerikanische Essayistin Susan Sontag ihren Band „Über Fotografie“  aus dem Jahr 1977 mit Anmerkungen zu Platons Höhlengleichnis und leitet dann über zur Kritik des zeitgenössischen Umgangs mit dem fotografischen Bild. Ähnlich wie auch bei der Interpretation der Schatten an der Höhlenwand verbindet sich, so ihre Grundthese, das Alltagsverständnis von Fotografien häufig mit der Zuschreibung eines unhinterfragten Realitätscharakters.
aus dem Jahr 1977 mit Anmerkungen zu Platons Höhlengleichnis und leitet dann über zur Kritik des zeitgenössischen Umgangs mit dem fotografischen Bild. Ähnlich wie auch bei der Interpretation der Schatten an der Höhlenwand verbindet sich, so ihre Grundthese, das Alltagsverständnis von Fotografien häufig mit der Zuschreibung eines unhinterfragten Realitätscharakters.
Die Begegnung mit der Welt draußen vor der Höhle (vor der Kamera) wird gar nicht mehr gesucht, sondern als wirklich gilt, was die Schatten (die Fotografien) zeigen. Der durchschnittliche Konsument von Bildern hat sich darin eingerichtet, das Vorgeführte als real zu betrachten, und ist nicht an Verunsicherungen interessiert.
„Die Fotografie impliziert, dass wir über die Welt Bescheid wissen, wenn wir sie so hinnehmen, wie die Kamera sie aufzeichnet“[1], bringt Sontag diese Haltung auf den Punkt. Fotografien werden als Beweis dafür betrachtet, dass eine Begebenheit in genau der Weise stattgefunden hat, wie es der kurze Augenblick der Aufnahme als Schnitt aus dem stetigen Strom des Geschehens suggeriert. Ob die Fotografie Bestandteil einer manipulativen Strategie sein könnte, wird in der Regel nicht geprüft. Und ob eine bestimmte Momentaufnahme repräsentativ für die Gesamtszene ist, spielt ebenfalls keine Rolle.
Der zornige Gesichtsausdruck einer bekannten Persönlichkeit wird deshalb schnell zum bösen Charaktermerkmal, wenn die Fotografie nur häufig genug gezeigt wird. Medienstrategien zur Verunglimpfung des politischen Gegners haben sich solche Mechanismen immer wieder zunutze gemacht.
Ein Vierteljahrhundert nach dem ersten Band hat sich Susan Sontag erneut und noch eindringlicher mit der moralischen Wirkungskraft der Fotografie befasst[2] – „Das Leiden anderer betrachten“  (Anmerkung der Redaktion). Insbesondere am Beispiel der Kriegsberichterstattung geht sie der Frage nach, ob Bilder nachhaltig aufrütteln können oder, umgekehrt, welche Umstände dem entgegenstehen. Beide Werke Susan Sontags beschäftigen sich mit dem Realitätscharakter von Fotografien. Handelt es sich bei ihnen um flüchtige Bildkonstrukte, die bestenfalls einen kontingenten Wirklichkeitsbezug aufweisen und nur für kurze Zeit einen oberflächlichen Sensationsvoyeurismus befriedigen, oder kann der durch eine Fotografie hervorgerufene Realitätsschock beim Betrachter eine nachhaltige, aufklärerische Wirkung auslösen?
(Anmerkung der Redaktion). Insbesondere am Beispiel der Kriegsberichterstattung geht sie der Frage nach, ob Bilder nachhaltig aufrütteln können oder, umgekehrt, welche Umstände dem entgegenstehen. Beide Werke Susan Sontags beschäftigen sich mit dem Realitätscharakter von Fotografien. Handelt es sich bei ihnen um flüchtige Bildkonstrukte, die bestenfalls einen kontingenten Wirklichkeitsbezug aufweisen und nur für kurze Zeit einen oberflächlichen Sensationsvoyeurismus befriedigen, oder kann der durch eine Fotografie hervorgerufene Realitätsschock beim Betrachter eine nachhaltige, aufklärerische Wirkung auslösen?
Zurück zu Platon
Susan Sontags Skepsis hinsichtlich der Authentizität und der Wirkung fotografischer Bilder erinnert an Platons Vorbehalte gegenüber dem künstlichen Abbild. Durch das Höhlengleichnis, die Kunsttheorie und die futuristische Pädagogik des künftigen Staates werden in der Politeia[3] die Grundlagen einer Philosophie gelegt, die bis in die Neuzeit nachwirkt. Friedrich Nietzsche ging so weit, in der platonischen Philosophie das zentrale Grundübel der Moderne zu sehen.[4] Alles Irrationale, alles Leidenschaftliche sei von Platon sowohl aus der Philosophie wie dem gesellschaftlichen Wertesystem entfernt worden. Stattdessen verblieben die Reduktion auf das vermeintlich Vernünftige und der Glaube an das Allheilmittel Wissenschaft. Vernunft versus Instinkt ist der von Nietzsche herausgearbeitete prägende Gegensatz.
Aufklärung versus Romantik oder Wissenschaft versus Kunst bilden verwandte Antagonismen. Der fototheoretische Diskurs, der das neue Medium seit seiner Erfindung begleitet, weist gewisse Parallelen hierzu auf. Relativ verbreitet und mit Wirkung bis in die Gegenwart ist auf der einen Seite eine Widerspiegelungsvorstellung, die der Fotografie eine sachliche, nüchtern dokumentierende Rolle zuweist. Dem gegenüber steht ein Verständnis von der Arbeit mit der Kamera, das sich eher an den Freiheitsgraden der klassischen Künste orientiert. Beide Ansätze beantworten die Frage nach dem Verhältnis von Realität und Abbild auf unterschiedliche Weise. Einen Konsens über das Wesen des fotografischen Bildes gibt es zwischen ihnen nicht.
Das Höhlengleichnis wird im siebenten Kapitel der Politeia entwickelt. Sokrates befindet sich im Gespräch mit seinem Schüler Glaukon. Platon lässt beide im Dialog schrittweise den Weg zur Erkenntnis des Wahren und Guten gehen. Die Versuchsanordnung ist schnell beschrieben: In einer Höhle lebt eine Gruppe von Menschen, angekettet und ohne die Möglichkeit sich umzuwenden. Vor ihren Augen befindet sich eine Wand, in ihrem Rücken der Höhleneingang. Hinter einer halbhohen Mauer gehen draußen vor der Höhle Menschen vorüber, die über ihren Köpfen künstliche Gegenstände, etwa Skulpturen, tragen und sich dabei unterhalten. Von diesen Dingen werden Schatten an die Wand im Höhleninneren geworfen. Platon lässt Sokrates die Frage stellen: „Auf keine Weise also können diese (die Höhlenbewohner; Anmerkung U. M.) irgendetwas anderes für das Wahre halten als die Schatten jener Kunstwerke?“ Und Glaukon antwortet: „Ganz unmöglich.“[5]
Die Schatten sowie die scheinbar von ihnen ausgehenden Stimmen sind im Bewusstsein der Höhlenbewohner die alleinigen Quellen ihrer sinnlichen Erfahrung. Sie bestimmen ihr Weltbild. Im weiteren Fortgang des Dialogs entwickeln Sokrates und Glaukon das Szenario, nach dem einer der Höhlenbewohner entfesselt wird und sich umblicken kann. Sobald er sich ein wenig an das Licht gewöhnt hat, wird er schemenhaft die Gegenstände wahrnehmen, von denen er bislang nur die Schatten sehen konnte. Dennoch wird er diese zunächst weiterhin für die eigentliche Realität halten, die Gegenstände hingegen für eine bloße Erscheinung. Außerdem wird ihm das helle Licht unangenehm sein, so dass er nur allzu willig wieder den alten Platz in der Höhle einnehmen würde. Wird er stattdessen gänzlich aus der Höhle an das Sonnenlicht gedrängt, kann er in der Helligkeit zunächst nicht viel erkennen, da die Augen geblendet sind. Erst nach einiger Zeit wird er die Dinge differenziert wahrnehmen, zunächst die künstlichen Statuen und Bildnisse und dann schließlich die Menschen sowie die Natur.
In den folgenden Abschnitten der Politeia zieht Platon den Analogieschluss vom Aufstieg aus der Höhle zur Wahrheitssuche. Letztlich gehe es darum, als Quelle allen Seins die Sonne zu erkennen. Deren Licht formt die Realität, die zur Ausgangsbasis für das Wirken der ordnenden Vernunft wird. Gleichzeitig vollzieht Platon den Schritt zur Ethik, indem er das Wahre mit dem Guten gleichsetzt. Dies zu verstehen bleibe aber die Leistung weniger Auserwählter, da für die Mehrheit der Menschen der beschwerliche und schmerzhafte Aufstieg aus der Höhle keine realistische Option sei. Das Streben nach der vollständigen Erkenntnis sei Aufgabe der Philosophen, an die er in diesem Sinne appelliert:
Ihr müsst […] wieder herabsteigen jeder in seiner Ordnung zu der Wohnung der Übrigen, und euch mit ihnen gewöhnen das Dunkle zu schauen. Denn gewöhnt ihr euch hinein: so werdet ihr tausendmal besser als die dortigen sehen, und jedes Schattenbild erkennen was es ist und wovon, weil ihr das Schöne, Gute und Gerechte selbst in der Wahrheit gesehen habt.[6]
Die Aufgabe der Philosophen bestehe darin, Deutungen zu den Schatten an der Wand anzubieten und auf die höhere Wahrheit außerhalb der Höhle zu verweisen. Es komme ihnen auf diese Weise eine priesterähnliche Funktion zu.
Konzentrieren wir uns auf die Grundkonstellation des Höhlengleichnisses, so fällt das mehrschichtige System von Wirklichkeitsebenen auf. Lassen wir die reflexive Sicht der Höhlenbewohner, also ihre Eigenbetrachtung, unberücksichtigt, so verweist Platon im Prozess des Höhlenaufstiegs auf drei unterschiedliche Realitäten. Zunächst gibt es als Alltagsrealität der Höhlenbewohner die Schatten an der Wand. Nach der Entfesselung und auf dem Weg nach oben werden dann als zweite Realität die künstlichen Gegenstände erblickt, die über die Mauer ragen. Erst im dritten Schritt werden die Urheber dieser Gegenstände und die vollständige Weltwirklichkeit wahrgenommen. Gekrönt wird der Aufstiegsprozess durch das Wissen um die Bedeutung der Sonne, durch deren Licht alles erst zur sichtbaren Realität wird.
Überträgt man die Metaphern des Höhlengleichnisses auf den Vorgang des Fotografierens, lassen sich die Schatten an der Wand mit der Kameraaufnahme vergleichen. Wie bei den Bildern in der Höhle handelt es sich bei einer Fotografie um das durch Licht geschaffene Abbild von etwas und nicht um die Realität an sich. Das mag zunächst selbstverständlich klingen. Weniger banal ist jedoch die Frage, von was die fotografische Aufnahme ein Abbild darstellt. Bei genauerer Betrachtung wird nämlich deutlich, dass grundsätzlich niemals ein Ding an sich fotografiert wird, sondern das Bild stets aus einer vom Fotografen mit der Kamera geschaffenen bestimmten Wirklichkeitssicht besteht.
Dieser Blickwinkel entspricht der durch das Objektiv gebündelten Perspektive. Sie ist damit weit entfernt von einer alle Perspektiven umfassenden ganzheitlichen Sicht. Bleibt das unberücksichtigt, so wird die Aufnahme für wahr gehalten, gleichwohl sie nur eine unter vielen Darstellungsmöglichkeiten ist. Wir sind es aber gewohnt, die Zentralperspektive als die natürliche Art der bildlichen Darstellung zu verstehen. Im Alltag existiert deshalb keine Vorstellung davon, dass es sich beim Fotografieren um einen kontingenten Akt handelt, der auch gänzlich anders hätte ausfallen können. Es gibt immer unendlich viele perspektivische Wahrheiten.
In der Regel werden solche komplexen Erkenntnisfragen aus lebenspraktischen Gründen ignoriert und das Bewusstsein begnügt sich mit einer einfachen Widerspiegelungstheorie: Dort befindet sich die Wirklichkeit, und hier ist ihr fotografisches Abbild. Dieses besitzt den Charakter eines Dokumentes mit Wahrheitswert, und die dem Bild zugeschriebene Objektivität bewirkt, dass man ihm eher Glauben schenkt als etwa einer mündlichen Erzählung oder dem Gemälde. Jenen unterstellt man grundsätzlich eine Tendenz zur Subjektivität, während der technische Vorgang des Fotografierens vermeintlicher Garant einer neutralen Sichtweise ist, die keine Spielräume offen lässt.
Fotografische Bilder […] scheinen nicht so sehr Aussagen über die Welt als vielmehr Bruchstücke der Welt zu sein; Miniaturen der Realität, die jedermann anfertigen oder erwerben kann.[7]
Fotografien werden als Ersatz für die Wirklichkeit genommen, und sie helfen dabei, die Komplexität des Realen auf einen überschaubaren Kern zu reduzieren.
Betrachten wir den Prozess der Wahrnehmung etwas genauer, gerät die Alltagstheorie schnell ins Wanken. Die Bedeutung einer Fotografie ergibt sich nämlich entgegen dem normalen Verständnis nicht unmittelbar, sondern ist Ergebnis eines unbewussten, mitunter aber auch bewussten Interpretationsprozesses. Der Betrachter nimmt gedanklich die Position des Fotografen ein, decodiert die Fotografie und gibt ihr schließlich einen Sinn. Darüber hinaus kann er sie einer kritischen Analyse unterziehen, um ihre Funktion im Medienkontext zu erschließen, etwa wenn es sich um Propagandamaterial handelt. Susan Sontag nimmt mit Unbehagen zur Kenntnis, dass genau eine solche Analyse im Zeitalter des massenhaften Bildergebrauchs nicht regelhaft stattfindet und es zur Absolutsetzung der bildlichen Realität kommt. Einen Grund hierfür bilden mentale Stabilisierungsmechanismen, und es ist „sicher nicht falsch, zu sagen, dass der Mensch einen zwanghaften Drang zum Fotografieren hat, einen Drang, Erfahrung in eine bestimmte Sichtweise zu verwandeln.“[8]
Fotografien schaffen durch die Fixierung einer eigentlich kontingenten Wirklichkeitssicht gewissermaßen Realität. Darüber hinaus manifestiert sich die Erinnerung an ein Ereignis nicht selten erst durch das spätere Anschauen der dabei entstandenen Aufnahmen. Ob es sich um Familienfotos handelt oder um Aufnahmen politischer Ereignisse, sie bestimmen unser Bild von dem, was stattgefunden hat.
Der moderne Mediennutzer will, so scheint es, wie sein angeketteter Vorgänger in der Höhle mit dem zufrieden sein, was ihm bildlich serviert wird. Sich den Dingen direkt zuzuwenden, sich an die eigene Wahrnehmung zu erinnern, könnte ja im Extremfall verwirren oder belasten.
Bilder tragen dazu bei, Ordnung in die Welt zu bringen. Was in früheren Jahren die Funktion von Heiligenbildern war, leisten heute die jährlich oder nach jedem Jahrzehnt erscheinenden Bildbände, die das politische, soziale und kulturelle Geschehen zusammenfassen und das kollektive Gedächtnis prägen. Geschichte reduziert sich auf das, was die Bände zeigen. Ganz Ähnliches gilt für die Geschichte der Fotografie selbst. Fotobücher, die uns das Sortiment der wichtigen Werke vorgeben,[9] helfen dabei, den Überblick zu bewahren. Und so leben wir in einer Welt der Bilder.
Erst wird unsere Vorstellung von der Welt durch Fotografien strukturiert. Im zweiten Schritt begeben wir uns auf die Metaebene und beschäftigen uns mit der akribischen Inventarisierung der Bilder selbst. Bilder zeigen uns, wie es war und wie es ist. Sie haben die Komplexität des Geschehens auf eine übersichtliche Menge an Informationen reduziert. Darüber hinaus verselbständigen sich einige von ihnen und werden zu begehrten Werken.
„Die Zeit erhebt die meisten Fotografien, auch die dilettantischsten, auf die Ebene der Kunst“,[10] fasst Susan Sontag diesen Vorgang zusammen. Man muss die Bilder nur entsprechend darbieten und am besten in einen musealen Kontext einbetten. Auf diese Weise werden sie ikonisiert und erhalten einen Wert an sich. Die einzelne Fotografie wird mit einer Bedeutung aufgeladen, die den Inhalt des Bildes in den Hintergrund treten lässt und sich stattdessen eher an Marktaspekten orientiert. Schließlich erhält sie das begehrte Kunstprädikat, wofür als Indikator nicht selten der Preis steht.
Für Platon wäre, hätte er die Fotografie als mimetischste aller Abbildungstechniken gekannt, eine solche Wertschätzung kaum vorstellbar gewesen. Als Erkenntnismittel ungeeignet, hätte wohl das Verdikt gelautet. Susan Sontag sah dies bei allen Vorbehalten weniger streng. Der Betrachter, so ihre Idee der Aufklärung, könne sich durchaus anhand einer Fotografie zur dahinter liegenden Wahrheit durcharbeiten. Potentiell ideologiebefrachtet bleibe das Bild nur dann, wenn man nicht über eine oberflächliche Schnellansicht hinausgelangt und den Charakter des Bildes als lediglich kontingente Möglichkeitsform übersieht.
Die platonische Bildtheorie
Wenn ein Künstler das Abbild eines bereits vorhandenen Gegenstandes schafft, verlässt er nicht die Sphäre des Materiellen und bleibt von der dahinter liegenden Ideenwelt getrennt. Sein Werk ist deshalb, so Platon, lediglich Nachahmung, Mimesis. Etwas Materielles wird gewissermaßen verdoppelt, wenn auch in vereinfachter Gestalt. Gute Kunst kommt zwar dem Schönen näher als eine schlechte Nachahmung, aber nur naive Gemüter, die keine Vorstellung von der höheren Ideenwelt besitzen, halten die sichtbare Realität bereits für die Wahrheit. Die Wertigkeiten sind in Platons Metaphysik klar geregelt: Die höchste Ebene bildet die Ideenwelt, darunter folgen die sinnlich erfahrbare Wirklichkeit und schließlich das aus dieser abgeleitete nachgeahmte Kunstwerk.
Platon entwickelt die wesentlichen Elemente seiner Kunsttheorie im zehnten Kapitel der Politeia, wobei er sich zunächst mit der Dichtkunst befasst. Diese sei für die Seelen der Zuhörer ein Verderb, da sie allzu häufig an Emotionen statt an den Verstand appelliere. Insbesondere gelte dies für die Theaterbühne, wenn alltägliche Begebenheiten zur Unterhaltung des Zuschauers so dargestellt werden, dass ein Spiegel des Banalen vorgehalten wird, ohne höhere Reflexionsebenen zu berühren. Für die bildende Kunst gelte aber durchaus Ähnliches.
Bevor Platon diesen Gedanken weiter entwickelt, befasst er sich am Beispiel von Objekten wie etwa einem Bett oder einem Tisch mit dem Verhältnis von Gegenstand und Begriff, denn wirkliche Betten und Tische gibt es viele, jedoch nur zwei Begriffe von ihnen. Diese Unterscheidung ist für die Betrachtung produktiven, schaffenden Handelns von wesentlicher Bedeutung. Wenn sich nämlich ein Handwerker daran macht, einen Tisch anzufertigen, so orientiert er sich bei der Planung zunächst an einer abstrakten Idee. Diese manifestiert sich in dem Begriff Tisch und existiert bereits vor seiner konkreten Entstehung. Allgemein ausgedrückt, die Welt beginnt mit einer Idee. Und woher stammen die Begriffe, wer hat die Ideen geschaffen? Es kann nach Platon nur der gleiche sein, der im Stande ist, „nicht nur alle Geräte zu machen, sondern auch alles insgesamt, was aus der Erde wächst.“[11]
Nach diesem Hinweis auf den göttlichen Ursprung allen Seins und aller Begriffe befasst sich Platon mit der Tätigkeit des Malers und lässt zunächst Sokrates die Frage an Glaukon stellen, ob dieser denn nicht bemerke, dass auch er selbst in der Lage sei, „auf gewisse Weise alle diese Dinge zu machen?“,[12] indem er nämlich mit Hilfe eines Spiegels die Wirklichkeit verdoppele. Nichts anderes tue der Maler, der ebenfalls ein scheinbares Bett schafft.
Während jedoch der Tischler immerhin etwas Nutzbares erzeugt, ist der Maler lediglich Nachbildner von etwas bereits Existierendem.
Damit sind die essentiellen Unterschiede der drei Betten beschrieben, des gemalten, des vom Tischler angefertigten und des begrifflichen. „Maler also, Tischler und Gott, diese drei sind Vorsteher der dreierlei Bettgestelle.“[13] Sie sind Nachbildner, Werkbildner und Wesensbildner. Gott hatte nur ein einziges Bett geschaffen, das Urbett als Begriff und Funktion, als Idee. Der Tischler transformiert diese Idee in die Realität, während der Maler den geschaffenen Gegenstand nachahmt, ohne dabei selbst Bezug auf die ursprüngliche göttliche Vorstellung zu nehmen.
Entspricht nun aber das vom Maler Nachgebildete, fragt Platon weiter, wirklich dem Original, oder gibt das Bild nicht vielmehr nur eine bestimmte, beschränkte Perspektive wieder?
Ein Bettgestell, wenn man es von der Seite sieht oder von gerade über oder wie sonst, ist es deshalb von sich selbst verschieden oder das zwar gar nicht, es erscheint aber anders?[14]
Die Antwort liegt auf der Hand. Es handelt sich immer um das mit sich selbst identische Bett, obwohl die Ansichten je nach Blickwinkel unterschiedlich ausfallen. Genau deshalb aber bleibt der Maler als Nachbildner eines bestimmten perspektivischen Blickes immer der Welt des Scheins verhaftet. Das Werk stellt niemals die Dinge an sich dar. Die Kunst, so Platons Verdikt, bestehe in der Täuschung, nämlich der Illusionierung eines Objektes, obwohl sich dieses durch Formen, Flächen und Umrisse als lediglich zweidimensionale Bildebene darstellt.
Darüber hinaus bewirke die Perspektivgebundenheit, dass der Maler keinen moralischen Maßstab vermitteln könne, denn das Gute und Schöne falle nun einmal mit der höheren göttlichen Wahrheit der Ideen zusammen und sei nicht aus der niederen Welt des Materiellen ableitbar. Der Künstler werde deshalb leicht der Gefahr erliegen, das nachzubilden, „was dem Volk und dem Unkundigen als schön erscheint.“[15] Die Nachbildnerei bleibt ein Spiel mit Illusionen und Täuschungen, vor der man warnen muss. „Selbst also schlecht, und mit Schlechtem sich verbindend, erzeugt die Nachbildnerei auch Schlechtes.“[16]
Abbildende Kunst steht deshalb unter dem Generalverdacht des Ideologischen oder Manipulativen, da sie grundsätzlich nichts mit Wahrheit, Schönheit und Moral zu tun hat.
Was kann dies alles für die Fotografie bedeuten? Zunächst liegt im Kontext des platonischen Denkens nahe, eine Parallele zwischen der Tätigkeit des Malers und der des Fotografen herzustellen. Mehr noch, die klassische Fotografie, zumindest gilt dies für die analoge Technik, entspricht bei genauer Betrachtung noch viel stärker dem von Platon verwendeten Begriff des Nachbildens, als es das auf der Leinwand entstandene Werk jemals sein kann. Der Maler ist in der Lage, Vorhandenes zu entfernen oder Dinge hinzuzufügen, für die es kein Vorbild in der Wirklichkeit gibt. Lässt man bei der analogen Fotografie Techniken wie Doppelbelichtungen, Retuschen oder Dunkelkammermanipulationen unberücksichtigt, so ist das mit der Kamera hergestellte Bild demgegenüber sehr viel wirklichkeitsgebundener. Auf dem Negativ sind bei normaler Belichtung ausschließlich Spuren von Objekten verewigt, die sich im Augenblick der Aufnahme vor der Kamera befunden haben. Kurz, Platon beschreibt recht präzise den Vorgang des fotografischen Abbildens.
Objektivität im Sinne von Wahrheit ist bei der Fotografie nicht zu erwarten. Die Fotografie eines Bettes ist nun einmal nicht identisch mit dem Bett selbst, sondern weist zwei Besonderheiten auf. Sie ist erstens aus einer bestimmten Perspektive aufgenommen, man hätte aber auch eine andere wählen können. Zweitens reduziert das fotografische Bild die dreidimensionale Wirklichkeit auf eine zweidimensionale Ebene mit Farben und Flächenumrissen. Sie ist also eine Abstraktion. Warum aber können wir trotz dieser reduzierten Eigenschaften des fotografischen Bildes die abgebildeten Gegenstände in der Regel richtig deuten? Warum wissen wir, aus welcher Perspektive auch immer aufgenommen, dass es sich um die Abbildung eines Bettes handelt?
Die Erklärung folgt Platon, denn sie verweist neben dem Bild des Bettes und dem wirklichen Bett auf die dritte Erscheinungsform, die begriffliche. Nur weil uns eine kognitiv abgespeicherte Vorstellung eines abstrakten Bettes zur Verfügung steht, können wir das abgebildete als solches identifizieren. Egal, ob das Foto ein hölzernes, vergoldetes oder ein Wasserbett zeigt, egal, ob es ein Einzel-, Doppel- oder Etagenbett in der Jugendherberge ist, egal, ob es im IKEA-Katalog abgebildet ist oder der Reportage über den feudalen Palast eines Mafiabosses entstammt, wir können die Fotografie als Abbildung eines Bettes deuten. Das ist nur möglich, weil wir neben den wirklichen und den abgebildeten Betten über die abstrakte Begrifflichkeit, diese ist nichts anderes als Platons Idee, und über das Wissen bezüglich der Funktion eines Bettes verfügen.
Während Platon von einer göttlichen Ideenwelt ausging, die den Begriff vorgibt, bringen wir dessen Wirksamwerden heute mit einem Lernvorgang in Verbindung. Das Kind kommt nicht mit einem angeborenen Apparat von Begriffen zur Welt und diese werden ihm auch nicht göttlich eingeimpft, sondern es wird im Verlaufe des Sozialisationsprozesses mit den Normen und den Objekten der umgebenden Kultur vertraut gemacht. Das zentrale Medium dabei ist die Sprache, ohne die es keine Begriffe und kein Denken gibt. Das Betrachten von Bilderbüchern hat deshalb genau hier seine Bedeutung. Dem Kind wird der Zusammenhang zwischen dem Bild des Autos, dem Begriff des Autos und dem wirklichen Auto vermittelt. Auf diese Weise lässt sich dann auch das richtige Verhalten im Straßenverkehr simulieren, zum Beispiel in der Schule oder in einem Zeichentrickfilm.
Verallgemeinert heißt das: Weil wir in einem Lernprozess einen begrifflichen Vorstellungsapparat im Sinne abstrakter Ideen aufbauen, können wir Fotografien verstehen. Sprache und Sinn werden im sozialen Kontext erzeugt. Sie fallen nicht vom Himmel. Obwohl eine Fotografie stets eine perspektivgebundene Darstellung zeigt und niemals ein Objekt an sich, sind wir aufgrund unserer erlernten Abstraktionsfähigkeit in der Lage, den Bildinhalt zu verstehen. Von Täuschung, wie Platon die nachbildende Kunst wertete, kann man vor diesem Hintergrund bei einer Fotografie allerdings kaum sprechen. Eine solche läge nur dann vor, wenn es überhaupt die Möglichkeit einer fotografischen Abbildung ohne Perspektivgebundenheit gäbe. Dies ist aber grundsätzlich nicht der Fall.
Einige von Platons Überlegungen erkennen wir auch mehr als zwei Jahrtausende später in den Diskursen zum Verhältnis von Fotografie und Realität wieder, ebenso bei der Frage, ob Fotografie überhaupt Kunst sei. Neue Sachlichkeit und Subjektive Fotografie bilden diesbezüglich ein idealtypisches Gegensatzpaar. Zu denen, die den technischen, objektiven Charakter des fotografischen Bildes betonen, gehörte Albert Renger-Patzsch.[17] Selbstbewusst bekannte er sich zum mimetischen Charakter des Fotografierens. Da es die sinnlich erfahrbare Wirklichkeit auf neutrale Weise wiedergebe und das fotografische Bild kein Ergebnis freier Subjektivität sei, unterscheide es sich grundlegend vom potentiell kreativen künstlerischen Gestalten eines Malers oder Bildhauers.
Aus ähnlichen Gründen verstand sich auch Cartier-Bresson nicht als Künstler, sondern als Handwerker. Beide eint eine Sichtweise, die den reproduktiven Charakter der Fotografie betont. Dort befindet sich die Wirklichkeit, und hier in einem direkten Entsprechungsverhältnis ihr Abbild. Weiterführende Aufgaben hinsichtlich einer Erkenntnis jenseits der empirisch erfahrbaren Realität werden der Fotografie bei diesem Konstrukt nicht abverlangt. Die komplexen Zusammenhänge, die Platon zwischen einem Objekt und dessen Abbildung erkannte, werden von einer sich selbst als sachlich verstehenden Fotografie nicht für relevant gehalten.
Den Gegensatz zur Neuen Sachlichkeit stellt die Subjektive Fotografie dar. Otto Steinert betonte die Gestaltungsmöglichkeiten des Fotografen und wies ein einfaches, neutrales Widerspiegelungsverhältnis zwischen Wirklichkeit und Abbild zurück.[18]
Die Fotografie kann sich nämlich vom Diktat des Realistischen befreien, wenn das Gestaltende das Reproduktive dominiert und der Fotograf seine besondere Sichtweise zur Grundlage des Bildes macht.
Dokumentarische Fotografie bedeutete noch technische Reproduktion und damit Mimesis, gestaltende Fotografie hingegen ist etwas qualitativ Neues und unterscheidet sich nicht von anderen Formen realitätsgelöster bildender Kunst. Eine Erkenntnis des transzendenten Wesens der Welt beanspruchte jedoch auch die Subjektive Fotografie nicht. Die Affinität zur Kunst genügte ihr.
Platon hätte der Neuen Sachlichkeit wohl entgegen gehalten, dass ihr Selbstverständnis die einschränkende Perspektivgebundenheit der Fotografie nicht ausreichend reflektiere und somit einer Scheinobjektivität verhaftet bleibe. Und die Subjektive Fotografie hätte er als schöne Illusion gewertet, die zwar ästhetisch reizvolle Sichtweisen eröffne, aber nicht zum Wesensverständnis des Abgebildeten beitrage. Genau mit dieser Begründung hatte Platon alle künstlerischen Techniken abgelehnt, die lediglich auf Wirkungen abzielten, aber nicht zum Blick hinter die Oberfläche der sinnlichen Erscheinungen anregten. Überhaupt galt ihm die Effekthascherei als zeitgenössisches Grundübel. Gemeint war die Kulissen- und Illusionsmalerei, die zu seiner Zeit erstmals die Möglichkeiten der Tiefendarstellung nutzte, um künstliche Bühnenwirklichkeiten zu erzeugen. Dies widersprach Platons Ziel der Wahrheitssuche und sollte in dem neu zu schaffenden Idealstaat aus pädagogischen Gründen untersagt sein. Kunst und Wahrheit hatten aus seiner Sicht nichts miteinander zu tun.
Vom einfachen zum komplexen Mimesisbegriff
Die Verbindung zwischen Vorbild und Abbild realisiert sich in einem Prozess, der seit der Antike unter dem Begriff Mimesis erörtert wird. Mimesis meint dabei Nachahmung oder auch, etwas vereinfacht, Verdoppelung: Hier ist die Wirklichkeit, dort ihr Abbild. Dabei verführt dieses Verständnis zur Annahme einer von jeder Erfahrung unabhängigen Realität. Genau dies aber ist in der Moderne zum Problem geworden. Existiert dieser Baum dort drüben, auch wenn niemand da ist, der ihn erkennt? Kognitionspsychologie und Erkenntnistheorie haben die Komplexität des Prozesses deutlich gemacht, in dem sich Wissen gleichermaßen wie Realität überhaupt erst konstituieren.
Das erinnert an die Geschichte von der Henne und dem Ei, und es gibt gute Gründe dafür, den seit der Antike etablierten Dualismus in Frage zu stellen oder ihn jedenfalls zu relativieren. Wenn aber die Realität ihren eindeutigen Charakter verloren hat und stattdessen eine perspektivische oder kulturell wandelbare Angelegenheit geworden ist, die einen, stets gesellschaftlich geprägten, Erkennenden voraussetzt, dann ist auch das Mimesisverständnis als simple Verdoppelung von Realität in Frage gestellt.
Christoph Wulf hat auf die Notwendigkeit einer Verfeinerung des Mimesisbegriffs und auf seine historische Entwicklung von Platon und Aristoteles bis zu den Zeichentheorien des Zwanzigstens Jahrhunderts und zum Poststrukturalismus hingewiesen.[19] Es zeigt sich, dass am Schlusspunkt dieser Entwicklung ein Mimesisverständnis steht, das nicht zuletzt für den zeitgenössischen Kunstdiskurs und die Frage nach dem Sinn und dem Wert von Fotografie relevant ist. Auf diesem Weg in die Moderne stellte die kopernikanische Wende den zentralen Meilenstein dar. „Mit dem Wegfall der Garanten einer gesicherten göttlichen bzw. menschlichen Ordnung sind die Referenzpunkte des Wissens erschüttert, verschieben sich und geraten in Bewegung“.[20]
Kurz, an die Stelle einer ontologisch abgesicherten Weltsicht traten in den Jahrhunderten seit dem Aufbruch in die Moderne nach und nach interpretierende Zeichen, die nicht nur das repräsentieren, was wir Wirklichkeit nennen, sondern die gleichermaßen konstitutiv sind für unser Wissen von dieser Wirklichkeit. Dies gilt sowohl für das systematisch strukturierte Wissen in Form von Theoriebildung wie auch für die Umweltrepräsentanz im Bewusstsein des Einzelnen. Spätestens seit Thomas Kuhn ist die Entwicklung des Wissens als Folge paradigmatischer Sprünge eine unumkehrbare Erkenntnis.[21]
Auch das antike Mimesisverständnis war bei genauer Betrachtung bereits durch einen aktiven Eigenanteil des Nachahmenden geprägt. So ging es Aristoteles nicht nur um simple Realitätsverdoppelung, sondern um die sinnliche Wahrnehmung, deren Interpretation und schließlich die bewusste Ausgestaltung des eigenen Handelns. Das Lernen des Kindes ist, wie er erkannte, das beste Beispiel für diesen Prozess. Es ahmt spielerisch nach, zunächst noch unbeholfen und mit den ihm zur Verfügung stehenden begrenzten Mitteln, dann aber nach und nach immer präziser. Heute würden wir dies als Sozialisationsprozess bezeichnen. Durch spielerische Imitation wird das Kind Teil der Gesellschaft und übernimmt deren vorgegebene Verhaltensmuster.
Dies gilt gleichermaßen für das Handeln wie für die Sprache. Beides wird mimetisch erlernt. Weil sich auch Platon dieser Prozesse bewusst war, hatte er bei der Beschreibung des künftigen Idealstaates so großen Wert auf die ausschließliche Darstellung des Positiven und Erwünschten in der Poetik und auf der Bühne gelegt. „Verbreitet werden sollen nur solche dichterischen Inhalte, von denen die jungen Wächter lernen und an denen sie wachsen können. Die Darstellung der Unzulänglichkeiten der Götter und großen Männer ist daher abzulehnen, und, wenn sie erfolgt, im Staat nicht zuzulassen.“[22] Platon fürchtete die üblen Folgen schlechter (Vor-)Bilder. Aristoteles vertrat hier eine etwas andere Auffassung, auf die wir noch zurückkommen werden.
Im Mittelalter und bis zum Beginn der Moderne wurde hinsichtlich des Mimesisbegriffs Wert auf die Repräsentanz des Göttlichen gelegt, ob in Form der Naturnachahmung oder der symbolhaften Darstellung transzendenten Geistes. Dabei wurde dem schöpferisch tätigen Künstler, anders als noch bei Platon, eine aktive Interpretations- und Gestaltungsrolle zugedacht. Seine Aufgabe bestand darin, die unendliche Kunst Gottes in eine vom Menschen geschaffene Dingwelt zu übersetzen. Der Natur als Erscheinung göttlichen Wirkens kam dabei eine besondere Bedeutung zu, und deren Darstellung wurde zur symbolischen Offenbarung des Wahren. Dieser Bezugspunkt relativierte sich jedoch nach Renaissance und Aufklärung und machte einem immer stärker werdenden Subjektivismus Platz. Zwar wird auch in Sturm und Drang, in Klassik und Romantik weiter mit dem Topos der Naturdarstellung gearbeitet, aber diese wird nun mehr und mehr zum Ausdruck subjektiver Innerlichkeit. Göttliches tritt in den Hintergrund.
„Nach dem Selbstverständnis der Romantiker zielt die Poetisierung der Welt auf einen Prozess, für dessen Ergebnisse es kein Vorbild gibt, das nachgeahmt wird, in dem vielmehr die ´poetische Welt` selbst das Ziel ist.“[23] Der Referenzpunkt des künstlerischen Schaffens ist nun nicht mehr das Transzendente und auch nicht die Wirklichkeit, Natur an sich, sondern die subjektive Variation von Reizen, egal welchen Ursprungs sie sind. Es wird eine imaginäre Welt hervorgebracht, die unabhängig von irgendeiner Realität ist. Der mimetische Bezugspunkt liegt, wie Nietzsche postulierte, im Künstler selbst. Dieses individualisierte Mimesisverständnis unterscheidet sich radikal von den antiken und mittelalterlichen Vorstellungen.
Die subjektivistische Befreiung ist ein Wesensmerkmal heutiger Kunst, die keine externen Referenzen mehr benötigt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich das Kunstwerk ausschließlich aus sich selbst heraus definiert. Vielmehr muss die Rolle des Rezipienten mitbedacht werden. Wulf macht deutlich, dass Kunst erst im Zusammenwirken von Werk und Betrachter entsteht. Durch das Kunstwerk wird zunächst bestenfalls etwas offeriert, das man als Sinnangebot bezeichnen kann. Die Manifestation findet dann anschließend im Prozess der Rezeption statt.
So weist kein Bild eine Bedeutung, einen Sinn an sich auf, sondern dieser entsteht im Prozess der Auseinandersetzung des Betrachters mit dem Werk. Ein solcher komplexer Mimesisbegriff, der nichts mehr mit einem Kopiervorgang zu tun hat, sondern auf einen künstlerischen Schaffensprozess verweist, der sich primär von einer Idee ableitet, egal wie diese entstanden ist, und sich in der interaktiven Rezeption des Werkes manifestiert, stellt sich als hoch kompatibel dar mit modernen Erkenntnistheorien. An die Stelle von Wirklichkeit und Abbild rücken Kategorien wie Sinn und Zeichen.
Im Zeitalter massenhaften Medienkonsums verwundert es nicht, dass der Unterschied zwischen Realität und Bild unklar geworden ist.
Für das alltägliche Erleben wird nicht Wirklichkeit zu Bildern, sondern Bilder werden zur Wirklichkeit.[24]
Die Komplexität des Geschehens wird nicht selten reduziert auf eine Fotografie. Aber das Bild ist nicht nur Gedächtnishilfe, sondern kann sich verselbständigen und zur eigenständigen Konstruktion von Sinn führen. Wirklich ist am Ende das, was die Fotografie zeigt. Darüber hinaus arbeiten Medien mit Bildern, die es bereits gibt, und konstruieren neue Collagen und Referenzialitäten. „Mehr und mehr Bilder werden produziert, die nur noch sich selbst zum Bezugspunkt haben und denen keine Wirklichkeiten entsprechen.“[25] Susan Sontag hatte das ganz ähnlich gesehen.
Nahezu alle Themen Platons sind auch heute noch präsent, die Fragen von Wirklichkeit und Schein ebenso wie die kritische Sicht auf mediale Vorbilder, die unter dem Generalverdacht stehen, eine schlechte Nachahmungswirkung auf das Verhalten auszuüben. Gleichwohl gibt es gute Gründe, Platons Höhlenmetapher nicht zum Ausgangspunkt einer generalisierenden Medienbeurteilung zu machen. Die Menschheit lebt nicht in einer Höhle, während draußen die wirkliche Wirklichkeit vorbeizieht, sondern das Sein gleichermaßen wie die Welt konstituieren sich parallel in einem wechselseitigen Prozess. Dieser zeichnet sich durch „einen offenen Horizont von Sinndeutungen und Sinnentwürfe(n)“[26] aus, mit dem man täglich aktiv umgehen muss, dessen Wahrnehmung man sich im Extremfall allerdings auch autistisch verweigern kann.
Grundsätzlich ist jedoch bei einem konsequenten konstruktivistischen Verständnis die dualistische Gegenüberstellung von subjektivem Bewusstsein und objektiver Außenwelt obsolet geworden.
Wenn es aber keine Höhlen und keine Gefangenen gibt, dann gibt es im Grunde nicht nur kein Außen, sondern ebenso sehr kein Innen! Es gibt in der Tat „keine Realität da draußen“, wohl aber ein Offenheits- oder Möglichkeitsbereich, der uns erlaubt, die Konstruktionen als Konstruktionen wahrzunehmen.[27]
Realität ist nicht ein für alle Mal statisch gegeben, wird andererseits aber auch nicht individuell beliebig konstruiert. Kultur und Gesellschaft bieten Sinnmuster an und setzen diese, nicht selten auch mit entsprechenden Druckmitteln, durch. Solange eine Reflexion dieser Prozesse möglich ist, sind wir nicht Gefangene, sondern Akteure mit gestaltendem Eigenanteil. „Eine Höhle entsteht nur dann, wenn bestimmte Sensenwürfe oder Konstruktionen sich verfestigen und als unantastbar erscheinen.“[28] Im Umkehrschluss geht es deshalb darum, den Kontingenzcharakter von Wirklichkeitssichten, und insbesondere auch von Bildern, in Erinnerung zu behalten. Das Leben findet nicht in einer für alle Beteiligten gleichermaßen eindeutigen Realität, sondern in einem Möglichkeitsbereich statt. In gleicher Weise stellt die Fotografie nicht eine Verdoppelung von Wirklichkeit dar, sondern vielmehr eine perspektivische Sicht, die auch anders hätte ausfallen können.
Im Rahmen eines konstruktivistischen Medienverständnisses ist die platonische Frage nach dem Verhältnis von Schein und Wirklichkeit eine komplexe Angelegenheit oder, bei radikaler Sichtweise, sogar hinfällig geworden. Einiges spricht dafür, dass die Unterscheidung von wirklicher Wirklichkeit und virtueller Wirklichkeit keinen Sinn macht. Und auch die platonische Kritik an der schlechten Vorbildfunktion destruktiver Bilder wird substanzlos, solange solche Bilder von Menschen rezipiert werden, die deren Charakter als grundsätzlich kontingente mediale Konstrukte erkennen und deshalb vor Infektion geschützt sind.
Ist eine Medienkompetenz allerdings nur schwach ausgeprägt oder gar nicht vorhanden, so besteht in der Tat die Gefahr der manipulativen Beeinflussung und einer unbewussten Übertragung fremder Sinnbotschaften in das eigene innere Weltbild.
Das Wahre und das Gute
Der Höhlenaufstieg ist nicht nur Metapher für eine Annäherung an die Wahrheit, sondern ebenso für den Weg zum absoluten Guten. Platons utopische Staatstheorie beinhaltet deshalb ein konsequentes Bildungs- und Erziehungsprogramm, das auch mehr als zweitausend Jahre später noch Wirkung zeigen sollte. Die Idealisierung der klassischen Vorbilder sowie die altsprachliche Gymnasialbildung knüpften im neunzehnten Jahrhundert an genau diesem Erziehungsziel an. Die geistige und körperliche Ausformung junger Menschen, ursprünglich war nur die männliche Jugend gemeint, sollte dem antiken Bildungsweg folgen, der zu Wissenschaft, Ethik und auch ästhetischem Verstand führt. Dieser Brückenschlag von der Wahrheitsfrage zur Moral, der von Nietzsche so vehement verurteilt wurde, ist von der Antike bis in die Gegenwart eines der philosophischen Kernthemen. Potentieller Bestandteil dieses Diskurses wird in der Moderne dann auch die Frage nach dem aufklärerischen Gehalt von Kunst generell und Fotografie im Besonderen.
Kann Fotografie wahr sein und zur Ausbildung eines moralischen Bewusstseins beitragen?
Die Künste waren für Platon auf dem Weg zu Wahrheit und Moral keine Hilfe. Dichtung und Kunst seien viel zu sehr der schönen Welt des Scheins verhaftet. Nicht einmal der von ihm in der Jugend verehrte Homer sei da eine Ausnahme. Eine praktische Relevanz habe dieser nämlich nie erlangen können, und die Wirkungslosigkeit sei Beweis für das Verhaftetbleiben seiner Dichtungen in einer künstlerischen Scheinwelt.[29] Mehr noch, Platon war davon überzeugt, dass mit der auf Wirkung bedachten Kunst nicht nur das Volk vom Streben nach der Wahrheitssuche abgehalten wird, sondern dass sie dazu beiträgt, selbst die eigentlich Wohlgesinnten zu verderben. Und auch die Förderung des triebhaften Lasters machte er ihr zum Vorwurf. „Denn sie nährt und begießt alles dieses, was doch sollte ausgetrocknet werden, und macht es in uns herrschen, da es doch müsste beherrscht werden, wenn wir bessere und glückseligere statt schlechtere und elendere werden sollen.“[30] Genau an solchen Formulierungen setzte Nietzsches Kritik der sterilen Philosophie Platons an.
Ursprünglich sind in Platons höherer Welt der Ideen auch die Seelen beheimatet, die sich jedoch in einem ewigen Zyklus von Abstieg und Wiederaufstieg befinden und sich während der Lebensphase des Menschen in die Welt der Materie aufhalten. Zwar ist die Seele an sich gut, muss sich aber in der weltlichen Phase den Niederungen des Seins erwehren, so dass sie wieder nach oben an das Licht strebt. Hier liegt die Chance für eine Höherentwicklung des Menschen. Das in der weltlichen, diesseitigen Existenz, im „barbarischen Schlamm vergrabene Auge der Seele“[31] wird nämlich durch philosophisches Denken auf den Weg des Höhlenaufstiegs geführt, hin zu Wahrheit und Moral, so dass sie nicht nur „schöner“ wird, sondern „viel bestimmter Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit unterscheidet“.[32] Die Seelenwanderung stellt sozusagen den dynamischen Antrieb dar, durch den der Drang zur Erkenntnis und zum moralisch Guten in Gang gesetzt wird.
Es ist eine Art ideeller Anthropologie, die Platon hier entwickelt. Das Streben nach dem Guten ist zwar kein unmittelbarer Bestandteil der menschlichen Bedürfnisnatur, aber die Seelenwanderung als metaphysischer Motor biete die Chance, die niederen Erscheinungsformen des Seins in Kontrast zu einem höheren Ideellen zu stellen, woraus sich die Motivation zum positivem Handeln ergibt. Aber leider, so Platon, verleitet auch alles Negative zur Nachahmung und führt auf einen falschen Weg. Wenn schon Mimesis, dann deshalb bitte in ausschließlich positiver Weise und in erhabener Absicht. Aristoteles hingegen grenzte sich von dieser Auffassung ab und schrieb auch den von Platon verworfenen negativen Erfahrungen eine potenziell aufklärerische Wirkung zu.
Nicht nur das Schöne, sondern grundsätzlich alles Anregende, selbst das Tragische, sei geeignet, das Gemüt aufzuwühlen und in kathartischer Weise den Geist zu höherer Erkenntnis zu treiben. Die künstlerische Beschäftigung mit den dramatischen Seiten des menschlichen Daseins bringe deshalb nicht zwangsläufig tragische Menschen hervor, sondern sei vielmehr geeignet, einen besseren Umgang mit den dunklen Seiten des Lebens zu fördern. Der Kunst könne auf diese Weise die Funktion einer Lehrmeisterin zukommen, denn sie biete auf kompensatorische Weise die Möglichkeit, Spannungen und deren Auflösung fiktiv so darzustellen, dass Erkenntnisse für das wirkliche Leben gewonnen werden. Mit Zensur jedenfalls, so Aristoteles, könne den menschlichen Leidenschaften nicht erfolgreich zu Leibe gerückt werden. Eher gehe es darum, in einem quasi-therapeutischen Prozess mit den Mitteln der Kunst das Ambivalente, Triebhafte und Unbewusste kenntlich zu machen, um dann nach dem Durchleben eines affektiven Fiebers diesbezüglich zu einem abgeklärten Umgang zu gelangen.
Für Platon war die Annäherung an das Reich der Wahrheit und des absolut Guten nur durch konsequente Vernunft sowie Leidenschaftskontrolle vorstellbar und wenigen philosophischen Geistern vorbehalten. Für Aristoteles hingegen lag die Wahrheit nicht in einer jenseitigen Ideenwelt, sondern in dem realen, die Menschen umgebenden Kosmos. Nur haben diese sich schon so sehr an die Schönheit der Natur gewöhnt, dass sie ihren erhabenen Charakter gar nicht mehr wahrnehmen. Sie sind aber nicht in einer Höhle gefangen, sondern befinden sich bereits auf Erden in der Welt des Göttlichen.[33] Folgerichtig hat Aristoteles eine Modifikation des platonischen Höhlengleichnisses vorgenommen, die ohne Seelenwanderung auskommt. Die demütige Einsicht in das Wirken der Götter sei jedem aufmerksamen und sensiblen Geist möglich, der nur bewusst genug die Wunder der Natur betrachte.
Das Original der aristotelischen Version des Höhlengleichnisses ist verloren gegangen,[34] es findet sich jedoch bei Cicero eine Zusammenfassung: „Wenn es Menschen gäbe, die stets unter der Erde gewohnt hätten, in gut eingerichteten, herrlichen Wohnungen, geschmückt mit Statuen und Gemälden, ausgestattet mit allem, was Menschen, die als glücklich gelten, in Fülle besitzen, die jedoch noch nie auf die Erde hinaufgekommen wären, aber durch Hörensagen etwas vom Walten einer Gottheit und von einer göttlichen Macht erfahren hätten, und dann, da sich irgendwann die Schlünde der Erde geöffnet hätten, jene verborgenen Wohnsitze hätten verlassen und zu den Orten, die wir bewohnen hätten herauskommen können: wenn sie nun plötzlich die Erde, die Meere und den Himmel gesehen, den Umgang der Wolken und die Gewalt der Winde kennengelernt, die Sonne erblickt und deren Größe und Schönheit, besonders auch ihr Wirken erkannt hätten, weil sie durch die Verbreitung ihres Lichtes am ganzen Himmel den Tag bringt, und wenn sie andererseits, sobald die Nacht die Länder beschattet, dann den ganzen Himmel sähen, von Sternen besät und geschmückt, und den Lichtwechsel des Mondes, wie er bald zu-, bald abnimmt, und der Auf- und Untergang all dieser Gestirne und ihre in alle Ewigkeit festgesetzten und unveränderlichen Bahnen – wenn sie dies alles sähen, würden sie gewiss glauben, dass es Götter gibt und dass diese gewaltigen Werke göttlichen Ursprungs sind“.[35]
Die drei Welten Platons werden bei Aristoteles gewissermaßen auf zwei reduziert. Da gibt es zunächst die unreflektiert wahrgenommene Alltagwelt des Scheins. Wenn man sich von diesem nicht blenden lässt und genauer hinschaut, erkennt man als zweite, wahre Welt die von den Göttern geschaffene Naturwirklichkeit. Das ähnelt sehr einer pantheistischen Auffassung und kommt ohne weitere Transzendenzzonen aus. Durch den Verzicht auf die platonische dritte Welt, das ist das Reich der Begriffe und Ideen, folgt das aristotelische Modell konsequent einer dualistischen Grundkonstruktion. Auf der einen Seite gibt es die Wirklichkeit und auf der anderen denjenigen, der sie erkennen kann.
Fotografie und Moral
Die Gegenüberstellung von Neuer Sachlichkeit und Subjektiver Fotografie hatte gezeigt, wie sich im fotografischen Diskurs der Neuzeit verschiedene Elemente der antiken Kunstreflexion wiederholen. Susan Sontag hat an einigen dieser Fragen angeknüpft und sich darüber hinaus mit dem ethischen Potential der Fotografie befasst.[36] Im Vergleich zwischen den Arbeiten von 1977 und 2003 sind dabei einige deutliche Veränderungen erkennbar. Dies hat wohl auch mit dem dramatischen Datum 9/11 und seinen Folgen für die Unterscheidung von terroristischer und zulässiger Gewalt sowie deren fotografischer Abbildung zu tun.
Susan Sontag scheint zunächst von einem nachhaltigen Skeptizismus geleitet, was die Rolle der Kamera im Kontext aufklärerischen Denkens anbelangt. Unbestreitbar ist, dass auch eine sozialkritische, sich als humanistisch verstehende Fotografie keine moralischen Positionen schaffen kann. Die Arbeit mit der Kamera mag zwar unter bestimmten Umständen dazu beitragen, bestehende Werthaltungen zu verstärken. Ist hingegen ein solcher normativer Kompass nicht vorhanden oder nur schwach ausgeprägt, bleiben Fotografien von Krieg, Gewalt und Armut mit großer Wahrscheinlichkeit sensationelle Bilder fremden Leidens ohne wirkliche Folgen für die eigenen Einstellungen.
Die Voraussetzung für eine moralische Beeinflussung durch Fotos ist die Existenz eines relevanten politischen Bewusstseins. Ohne die politische Dimension wird man Aufnahmen von der Schlachtbank der Geschichte höchstwahrscheinlich nur als unwirklich oder als persönlichen Schock empfinden.[37]
Die Bilder sind dann bestenfalls geeignet, einen Anschein von Teilnahme zu erwecken. Aber das eigene Gewissen, das ja bestenfalls oberflächlich quält, beruhigt sich schnell wieder.
Die moderne Medienwelt ist voll von solchen Bildern. Aber genau hier liegt auch das Problem, denn es gibt eine Ökonomie des Massenhaften. Zwar können Fotos erschrecken, wenn sie etwas Unerwartetes zeigen, aber der Effekt nutzt sich ab und der Einsatz muss erhöht werden, soll die ursprüngliche Wirkung noch einmal eintreten.
Die Schockwirkung fotografierter Gräueltaten lässt bei wiederholter Betrachtung nach, genau wie die Überraschung und Verwirrung, mit denen man den ersten pornographischen Film betrachtet, nachlassen, sobald man sich weitere ansieht.[38]
Die meisten Fotos verlieren deshalb im Laufe der Zeit an Wirkung und Dynamik. Entweder werden dann die Empörung und das Entsetzen schwächer, oder aber die Dosis muss erhöht werden. Beides spricht gegen die Hoffnung, schreckliche Bilder würden quasi von selbst zum Stimulanzmittel für ein Auftreten gegen die Grausamkeit in der Welt. Dabei hatte Susan Sontag selbst in der Jugend beim Betrachten der Aufnahmen aus Bergen-Belsen und Dachau den verstörenden Schock erfahren, der sich durch die Erkenntnis des Bösen einstellt, und sie hat diesen Schock eigenem Bekunden nach zeitlebens nie vergessen.
Trotz dieser Erfahrung bleibt Sontag vorsichtig. Insbesondere die gutgemeinte humanistische Fotografie ist in ihren Augen eine ambivalente Angelegenheit. Schon immer hat diese alle Formen von Unterdrückung und Gewalt zu einem bevorzugten Thema gemacht.
Soziales Elend hat die im Wohlstand Lebenden stets unwiderstehlich zum Fotografieren angeregt – der schmerzlosesten Art, etwas zu erbeuten, um damit eine verborgene, das heißt, eine ihnen verborgen gebliebene Realität zu dokumentieren.[39]
Solche Bilder sind zwar geeignet, das moralische Gefühl des Betrachters anzusprechen, aber sie lösen häufig keinen wirklichen politischen Lerneffekt aus.
Es bleibt eine „Erkenntnis zu Ausverkaufspreisen“,[40] die nicht untypisch ist für die indifferente Geisteshaltung der wohlmeinenden Mittelschicht. Deren Humanismus empfindet auf nahezu voyeuristische Weise die Elendsviertel als schaurig reizvollen Kontrast zum eigenen beschützten Dasein, und die Kamera dient nicht selten der Schaffung eines am Ende auch noch ästhetisch durchkomponierten Bildes der fremden Armut. Das intellektuelle Großstadtpublikum betrachtet solche Kunst als eine Art Härtetest, dem man sich gezielt aussetzt, um zu beweisen, was man alles aushält.
Überhaupt die Ästhetik. Susan Sontags Beschreibung des lärmenden Bildersensationalismus hebt an mehreren Stellen dessen Vorliebe für das Gestalterische hervor. Dabei folgt sie Walter Benjamin, der bereits zu seiner Zeit die besondere Fähigkeit der Kamera registriert hatte, alle Sujets zu verklären, ob nun eine Fabrik oder einen Abfallhaufen.Es sei der Fotografie gelungen, „selbst tiefste Armut auf eine modische, technisch perfekte Weise zu einem Gegenstand des Genusses zu machen.“[41] Häufig wird in solchen Motiven auf eine inhaltlich indifferente, stark das Formale betonende Weise das Ästhetische gefunden, ob nun als gestaltete Komposition oder durch eine elegante Perspektive.
Selbst eine erläuternde Bildunterschrift, die auf das Ausbeuterische der dargestellten Kinderarbeit verweist, mag zwar moralisch gut gemeint sein, ändert aber nichts an der verklärenden Wirkung der Aufnahme. Es ist und bleibt eine ambivalente Angelegenheit. Bilder können den Betrachter quälen, aber „die letztlich ästhetisierende Wirkung der Fotografie bringt es mit sich, dass das gleiche Medium, das das Leid vermittelt, es am Ende auch neutralisiert.“[42]
Die Gefühle werden auf Distanz gebracht, wenn die Fotografie „die Welt in ein Warenhaus oder ein Freiluftmuseum verwandelt, in dem alles zum Konsumartikel abgewertet, zum Gegenstand der ästhetischen Würdigung erhoben ist.“[43]
Susan Sontag zieht in ihrem Essay von 1977 eine ernüchternde Bilanz. Die Fotografie kann zwar unter bestimmten Umständen eine nachhaltige Berührung auslösen wie etwa bei den Bildern aus Bergen-Belsen, im Prinzip aber ist sie eine reichlich substanzlose Angelegenheit mit mangelhafter Ernsthaftigkeit und von nur oberflächlicher Wirkung. Dazu trägt nicht zuletzt das Bemühen um den schönen Blick bei, der an Platons Verdikt erinnert, die nachahmende Kunst suche die Gunst des Publikums und stelle den Schein über die tiefere Erkenntnis.
Was eine solche ausmachen könnte, deutet Sontag lediglich an. Zwar spricht sie in eher allgemeiner Weise von moralischem und politischem Bewusstsein, es bleibt in dem Essay von 1977 jedoch einiges offen. Weder die Frage, ob es einen universellen Maßstab für moralisches Bewusstsein gibt, noch die Frage nach dem Verhältnis von Realität, was auch immer das ist, und Bewusstsein werden nachhaltig untersucht.
Fotografie bleibt, fasst man Susan Sontags Position etwas grob zusammen, ein Scheingeschäft im Sinne Platons. Deshalb schleift sich der durch Bilder erzeugte Schock bei Wiederholungen ab. Nachhaltige kathartische Wirkungen für das individuelle Bewusstsein oder die kollektive Moral sind von der Fotografie nicht oder nur selten zu erwarten.
Etwa ein Vierteljahrhundert nach dem Erscheinen des ersten Essaybandes erscheint Sontags „Das Leiden anderer betrachten“. Kurz davor wurde Amerika durch den Anschlag auf das World Trade Center erschüttert und in der Folge kam es zur militärischen Intervention im Irak. Die hierdurch aufgeworfenen Fragen nach der Unterscheidung von mörderischer und gerechter Gewalt sowie deren medialer Darstellung führen Sontag zu einer schärferen Positionierung als noch 1977. Insbesondere bedeutet dies nun Parteinahme, denn das Betrachten des Leidens anderer kann zwar theoretisch aus einer allgemeinen universalistischen Haltung heraus erfolgen.
In der Praxis gibt es jedoch kaum Beispiele dafür, dass Gewaltakte aus allen Perspektiven gleichermaßen verurteilt werden. Mitgefühl entsteht nahezu immer, ob bewusst oder unbewusst, auf der Basis des eigenen, somit kulturgebundenen Wertefundaments, denn „wer davon überzeugt ist, dass das Recht nur auf einer Seite, das Unrecht und die Unterdrückung aber auf einer anderen Seite zu finden sind und dass der Kampf fortgesetzt werden muss, für den kommt es darauf an, wer von wem getötet wird.“[44] Es geht also um den eigenen Standpunkt, und die Beurteilung von Gewaltakten erfolgt nahezu immer vor dem Hintergrund der Gerechtigkeitsfrage. Diese wird jedoch von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich beantwortet, und im Zweifelsfall werden auch universalistische Menschenrechtspositionen unter Berücksichtigung der jeweils eigenen Perspektiven oder partikularer Interessen ausgelegt.
Susan Sontag hält es für eine europäische Besonderheit, sich aus grundsätzlichen Erwägungen gegen jede Form von Krieg zu positionieren. Die meisten Menschen der meisten Länder dieser Welt würden hingegen deutlich zwischen Kriegen unterscheiden, die der Interessenlage des eigenen Landes dienen, und den Kriegen anderer Nationen, die schnell als grausam und ungerecht abgelehnt werden. Gleiches geschieht bei der Beurteilung von Kriegsfotografien. Gewaltakte der eigenen Seite werden anders bewertet als entsprechende Akte des Gegners.
Die allgemeine und grundsätzliche Ablehnung jeglicher gewaltsamer Auseinandersetzungen als universalistische ethische Position ist deshalb ein Sonderfall und historisch relativ neu. Wenn aber in der eigenen Perspektive ein Krieg als notwendig vorstellbar ist, muss das Auswirkungen auf die Kriegsfotografie haben. Man kann dann von dieser nicht erwarten, gegen jede Form von Gewalt aufzutreten, unabhängig von wem sie ausgeht. Und selbst Begriffe wie Tapferkeit und Opferbereitschaft wären zu rehabilitieren, da sie im Falle eines gerechten Krieges ihren Sinn und ihre Glaubwürdigkeit nicht verloren hätten. Die Fotografie eines Elitesoldaten mag nun einmal für den einen das Bild eines Helden darstellen, für den anderen ist es ein testosterongesteuerter Macho im Dienste imperialer Mächte.
Das Leben ist unübersichtlich geworden. Die globalisierte Welt fordert eine Haltung, die über das Mitleiden mit den Betroffenen eines fernen Krieges hinausgehen und das politische Nachdenken einbeziehen muss. Darüber hinaus handelt es sich oftmals um Kriege, die direkt oder indirekt etwas mit dem westlichen Wohlstand zu tun haben. Die Armut anderer steht in vielerlei Hinsicht in einem direkten strukturellen Zusammenhang mit dem eigenen Reichtum. Mitleiden ohne politisches Bewusstsein dieser Zusammenhänge bleibt deshalb affirmativ und sichert die bestehenden globalen Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Umgekehrt bedeutet dies aber, so Susan Sontag, dass aus Mitleiden ein moralisches Urteil entstehen kann, wenn „uns Mitleid als jene Gefühlsregung erscheint, die wir, wie Aristoteles behauptet, nur denen schulden, die unverdientes Unglück erleiden.“[45] Dies erfordert aber die Analyse des Kontextes, in dem konkretes Leiden entstanden ist. Welches Unglück ist unverdient, welches nicht? Und ist die Fotografie in der Lage, eine solche Kontextualisierung zu leisten?
Die Dinge werden aber noch komplizierter. Der nüchternen Reflexion über die Hintergründe der Kriegs- und Gräuelbilder steht nicht selten eine offensichtliche Lust am Betrachten des Schrecklichen entgegen.
Anscheinend ist der Appetit auf Bilder, die Schmerzen leidender Leiber zeigen, fast so stark wie das Verlangen nach Bildern, auf denen nackte Leiber zu sehen sind.[46]
Susan Sontag beschreibt hier, eingehender noch als in ihrem Essayband von 1977, psychische Mechanismen zwischen Begierde und Vernunft, die wir oftmals nicht wahrhaben wollen. Ganz offensichtlich ist nämlich im Menschen „eine Neigung zum Grauenhaften angelegt“,[47] so dass es eben nicht nur bloße Neugier ist, die uns beim Unfall auf der Gegenspur der Autobahn einen Stau verursachen lässt, sondern der Wunsch nach dem Anblick des Grausigen. Schon die mittelalterlichen Darstellungen von Höllenqualen haben an dieser Begierde angesetzt.
Im allgemeinen Bewusstsein wird schnell das Urteil gefällt, die Lust am Grauen sei vulgär. Dabei wird übersehen, dass es sich bei dieser Begierde ganz offensichtlich um einen Bestandteil der Triebstruktur handelt, die nicht einfach mit moralischen Bewertungen aus der Welt zu schaffen ist. Wer sich von dieser Erkenntnis überraschen lässt und schnell vergisst, zu welchen Grausamkeiten Menschen zu allen Zeiten und in allen Kulturen in der Lage sind, der ist, so Susan Sontag, „moralisch oder psychologisch nicht erwachsen geworden.“[48]
Denn die Bilder sagen uns, dass es Grausamkeiten jenseits aller Entrüstung und unabhängig von dem Wunsch, sie beseitigen zu wollen, gibt und wohl auch immer geben wird. Und es muss davon ausgegangen werden, dass Menschen aus eigenem Antrieb, mit Begeisterung und mit selbstgerechter Überzeugung Grausamkeiten zu begehen in der Lage sind. Aber das wollen wir nicht wahrhaben. Zwar pflegen wir eine Erinnerungskultur an die Grausamkeiten vorangegangener Generationen, wollen uns aber weniger mit der Frage befassen, wie es mit den Begierden und Gewaltpotentialen in der eigenen Gegenwartsgesellschaft aussieht. Trauergeleitetes Erinnern an frühere Schrecken allein genügt nicht. Die beim Betrachten des Leidens anderer ablaufenden inneren Prozesse sind jedenfalls wesentlich vielschichtiger, als es ein wohlmeinender Humanismus wahrhaben möchte, und die in diesem Konglomerat enthaltenen lustvollen Anteile füllen nicht nur die Kinos, sondern sind die Basis eines sensationsgierigen Bildjournalismus.
Die aristotelische Wende bei Susan Sontag
Platon hatte es geahnt. Die Macht der Bilder kann bewirken, dass der Verstand auf der Strecke bleibt. Und an eine kathartische Funktion von Schreckensdarstellungen vermochte er, anders als nach ihm Aristoteles, nicht so recht zu glauben. Susan Sontags Medienanalyse knüpft in gewisser Weise am Urteil Platons an. In anderer Hinsicht jedoch scheint die Affinität zu Aristoteles eine größere zu sein. Lassen wir aber zunächst noch einmal die platonische Seite zu Wort kommen:
In einer Welt, in der die Fotografie vor allem zu konsumistischen Manipulationen dient, kann man sich der Wirkung keines noch so bedrückenden Fotos mehr sicher sein.[49]
Das ist harte Ideologiekritik, und Sontag macht keinen Hehl aus ihrem Generalverdacht gegenüber dem fotografischen Bild. Aber dennoch, so sehr die These richtig sein mag, dass die Masse der alltäglichen Gebrauchsbilder für vollkommen belanglose, aber eben auch manipulative Zwecke oder Herrschaftsinteressen eingesetzt wird, so gibt es eine Dialektik der Abnutzung, die einer solchen Wirkung auf längere Sicht entgegenläuft.
Wir werden mit Bildern jeglicher Art überschwemmt, so dass kaum noch vorhergesehen werden kann, welche davon eine nachhaltige Wirkung entfalten und welche nicht. Womit über die Art der Wirkung noch nichts gesagt ist. Mitunter ist es ein reiner Sensationsvoyeurismus, der bedient wird. Aber manche Bilder können auch politische Folgen haben wie etwa die Aufnahme von der Erschießung eines Vietkongs durch den Saigoner Polizeichef auf offener Straße.
Dieses und ähnliche Bilder aus dem Vietnamkrieg haben dazu beigetragen, dass in Amerika der Widerstand gegen den militärischen Einsatz des eigenen Landes eine immer breitere Basis fand. Die meisten Fotografien jedoch, auch die grausamen, werden relativ schnell wieder vergessen, ohne dass sie eine solche nachhaltige Wirkung entfalten. Es drängt sich deshalb eine Analyse des offensichtlich nicht seltenen Gewöhnungsmechanismus auf, der potentiell alle Bilder treffen kann. Und nicht zuletzt das Fernsehen fördert durch die immanente Medienlogik der andauernd neuen Bilder eine solche Abstumpfung. Es kommt zu einer Gleichrangigkeit aller Bilder, so dass die Kriegsgräuel „zu einer allabendlichen Belanglosigkeit“[50] verkümmern und das Mitgefühl zwangsläufig erlahmt.
In der praktischen Fotografie führt dieses Phänomen zu gegenläufigen Reaktionen. Mitunter wird der Versuch unternommen, in der Masse durch eine Erhöhung der Dosis aufzufallen. Und wenn die Intensitätssteigerung des abgebildeten Grauens aus Gründen der schleichenden Abnutzung nicht mehr ausreicht oder eine absolute Obszönitätsgrenze erreicht ist, die man nun wirklich nicht mehr überschreiten kann, werden eine besondere Art der Bildinszenierung oder der Gestaltungsaufwand zum Mittel der Wahl. Auf diese Weise gelangt man zum Paradox des ästhetischen Bildes mit dem grausigen Inhalt, in der Malerei eine bekannte Erscheinung, wie Sontag anhand „schöner“ blutrünstiger Schlachtszenen oder dem erhaben dargestellten Tragischen zeigt.[51]
Für Aufnahmen mit der Kamera erscheint ein vergleichbares Vorgehen befremdlich und gefühllos, aber trotz dieser instinktiven Vorbehalte gibt es selbst vom Einsturz der Twin Towers in New York ästhetisch anmutende apokalyptische Bilder, die nach allen Regeln der Fotokunst gestaltet zu sein scheinen. Die Diskussion darüber, ob dies zulässig sei, ließ nicht auf sich warten.[52]
Unabhängig von Geschmacksfragen hinsichtlich der Grenzen des im Bild Darstellbaren sind Fotografien einerseits, wenn auch perspektivische, Dokumente wie andererseits potentielle Bildkunstwerke. Wird der ästhetische Aspekt allerdings so stark in den Vordergrund gestellt, dass allein hierdurch die Bildwirkung bestimmt wird, mag das zwar die Aufmerksamkeit fördern, es lenkt jedoch schnell von einer emotionalen Berührung ab.
Um dem Ästhetizismusvorwurf zu entgehen, ziehen es manche Fotoberichterstatter deshalb vor, sich moralisch korrekt zu geben und bewusst „das Spektakuläre unspektakulär zu machen.“[53] Solche Bilder wirken authentischer und weniger manipulativ. Sie erwecken nicht im gleichen Maße den Eindruck, dass sie es auf Wirkung, eilige Identifikation und billiges Mitgefühl anlegen. Hier zeigt sich die zweite Strategieoption zur Aufmerksamkeitssteigerung in der Bilderflut. In diesem Fall ist es nicht die betont künstlerische Fotografie, sondern gerade das Gegenteil, das Bild ohne gutes Aussehen.
Die Dinge sind ambivalent. Dramatische Fotografien können Wirkung zeigen. Sie können uns berühren und Mitleid zur Folge haben, sie können uns aber auch voyeuristisch reizen. In beiden Fällen sind wir mit großer Wahrscheinlichkeit einer Dynamik nachlassender Spannung ausgesetzt. Darüber hinaus können wir Fotografien als Sachdokumente betrachten, oder wir nehmen sie mit der ästhetischen Brille wahr und schreiben ihnen womöglich sogar das Kunstattribut zu. Alle diese Aspekte sind bei einigen der bekannten 9/11-Aufnahmen vereint. Da wir dies spüren, mag sich zusätzlich ein Gefühl von Beschämung hinzumischen.
Als Fazit verbleibt ein irgendwie mulmiges Gefühl hinsichtlich des Wesenscharakters der Fotografie.
Betrachten wir nun die aristotelische Seite bei Susan Sontag. Es scheint, so ihre Wahrnehmung, Fälle zu geben, bei denen entgegen dem üblichen Nachlassen der Spannung kein Verfallsdatum für den Schock eintritt und bei denen sich „eine tiefempfundene Reaktion durch wiederholte Konfrontation mit dem, was schockiert, bekümmert, erschüttert, nicht abschleift.“[54] Eine Abstumpfung tritt also offenbar nicht zwangsläufig ein, und Sontag ist sich im Jahr 2003 ihrer eher skeptischen Thesen von 1977 „nicht mehr so sicher.“[55] Es mag nämlich neben der schleichenden Gewöhnungsdynamik einen zweiten, damit zusammenhängenden, Mechanismus geben, der sich im Kern als ein sinnvoller Schutzmechanismus darstellt. Warum, fragt sie, solle man nicht das Recht haben, sich emotional vom Leiden anderer abzugrenzen, also in der inneren Distanz zu bleiben?
Sontag lehnt den moralischen Rigorismus ab, der eine solche Reaktion nicht akzeptieren will.
Es ist kein Fehler, kein Zeichen von Schwäche, wenn wir keine Verbrennungen davontragen, wenn wir nicht genug leiden, während wir diese Bilder sehen.[56]
Den Verstand zu gebrauchen, um Abstand zu nehmen und die ambivalenten Sachinhalte und Wirkungen einer Fotografie nicht vorschnell einzuebnen, hat nichts mit emotionaler Kälte oder Teilnahmslosigkeit zu tun, sondern mag dazu beitragen, das Bewusstsein für die Strukturen dieser Welt zu schärfen, um dann, und erst dann, sinnvoll zu handeln. Wir können Bilder als schockierend bewerten, ohne selbst einen physischen Schock zu erleiden. Das ist etwas anderes als Abstumpfung. Mehr noch, Innehalten und in Distanz gehen sind sinnvolle Tugenden, denn niemand kann „gleichzeitig nachdenken und zuschlagen“.[57] Dies gilt, lässt sich hinzufügen, nicht nur für das einzelne Individuum, sondern im übertragenen Sinne auch für Staaten und deren kriegerische Ambitionen.
Susan Sontag geht in ihrem Essay von 2003 an einer weiteren Stelle deutlich über die Positionierungen von 1977 hinaus. 9/11 sowie auch die militärischen Reaktionen Amerikas hatten deutlich gemacht, dass Gewalt nicht nur eine Angelegenheit fremder Menschen in irgendeinem Teil der Welt ist, sondern dass sie hautnah die eigenen Freunde und Verwandte treffen kann. Eine bequeme voyeuristische Haltung im Fernsehsessel oder vergeistigte Konstrukte elfenbeinerner Kopfgeburten verlieren vor diesem Hintergrund ihre Daseinsberechtigung.
Eine besondere Erscheinungsform der gebildeten Verantwortungslosigkeit stellen für Sontag angesichts des real gewordenen Todes gewisse Formen intellektueller Spielereien dar, denen sie vorwirft, nur noch simulierte Realitäten zu kennen und die Abdankung der Wirklichkeit zu verkünden. Dies alles sei phantasievolle Rhetorik und „auf atemberaubende Weise provinziell“,[58] ähnlich wie früher die Meldungen vom Tod der Vernunft, des Intellektuellen oder der Literatur. Diese Haltung „nimmt an, dass jeder Mensch Zuschauer ist, und suggeriert – absurderweise und völlig unseriös -, dass es wirkliches Leiden auf der Welt gar nicht gibt. Es ist aber unsinnig, die Welt mit jenen Zonen in den wohlhabenden Ländern gleichzusetzen, wo Menschen das zweifelhafte Privileg haben, die Rolle dessen zu übernehmen (oder auch abzulehnen), der zusieht, wie andere leiden.“[59] Dies sei geübter Zynismus aus der Welt der risikofreien Ferne.
Hier wird noch einmal die aristotelische Wende bei Susan Sontag deutlich. Es war ein langer Weg von der Betrachtung der Fotografie als ein Scheingeschäft im Sinne Platons hin zur Erkenntnis ihrer potentiell auch aufklärerischen Wirkung, die schon Aristoteles der Kunst nicht absprechen wollte. Denn es gibt eine Wahrheit des Leidens. Wir verspüren sie beim Betrachten mancher Fotografien, aber wir dürfen dennoch ohne schlechtes Gewissen die Chance wahrnehmen, uns nicht selbst vor Mitleid zu verzehren, sondern stattdessen den Verstand einzusetzen, um den Kontext der abgebildeten Gewaltszene und die richtige Reaktion herauszufinden.
Eine kathartische Wirkung von Fotografie steht deshalb in einem engen Zusammenhang zur Fähigkeit der politischen Reflexion. Darüber hinaus geht es um die philosophische Wirklichkeitsfrage. Auch hier gibt Susan Sontag eine klare Antwort. Jeder, der Krieg erlebt hat und dem Tod glücklich entronnen ist, wird bestätigen, dass das Leiden real ist. „Und sie haben recht“,[60] beendet sie ihre Analyse des moralischen Potentials der Fotografie. Bilder konkreten Leidens sind mehr als poststrukturalistische Zeichen aus einer relativen Welt gar nicht existierender Wirklichkeiten oder platonische Höhlenkonstruktionen.
Dieser Text ist der Webseite Fotosinn entnommen – dort findet Ihr auch weitere Essays zum Thema Fotografie.
Quellen und Anmerkungen
1. ↑ Sontag, Susan: Über Fotografie; Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M., 1980 (zuerst im Original 1977), S. 28
2. ↑ Sontag, Susan: Das Leiden anderer betrachten; Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M., 2005 (zuerst im Orginal 2003)
3. ↑ Platon: Der Staat (Politeia); Akademie Verlag, Berlin 1985, Bibliothek Alexandria; der zugrunde liegende Text geht auf die Schleiermacher-Ausgabe von 1817 bis 1828 zurück; bei nachfolgenden Zitaten ist die Rechtschreibung vorsichtig modernisiert
4. ↑ siehe etwa Cardoso, Martin: Der platonische Nietzsche; Dissertation, Humboldt Universität zu Berlin, 2010; S. 93
5. ↑ Platon: a. a. O., S. 248
6. ↑ ebd., S. 255
7. ↑ Sontag, Susan: Über Fotografie; a. a. O., S. 10
8. ↑ ebd., S. 30
9. ↑ siehe zum Beispiel: George Eastman House: 1000 Photo Icons; Taschen, Köln , 2000
10. ↑ Sontag, Susan: Über Fotografie; a. a. O., S. 27
11. ↑ ebd., S. 353
12. ↑ ebd.
13. ↑ ebd., S. 354f.
14. ↑ ebd., S. 356
15. ↑ ebd., S. 362
16. ↑ ebd., S. 363
17. ↑ vgl. Metzmacher, Ulrich: Konstruktivistischer Realismus; in: www.fotosinn.de
18. ↑ ebd.
19. ↑ Wulf, Christoph: Mimesis; aufgerufen am 18. September 2015
20. ↑ ebd., S. 83
21. ↑ Kuhn, Thomas: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen; Suhrkamp, Frankfurt a. M., 1967
22. ↑ Wulf, Christoph: a. a. O., S. 90
23. ↑ ebd., S. 101
24. ↑ ebd., S. 114
25. ↑ ebd., S. 119
26. ↑ Rafael Capurro hat den Film in einem Text von 1999 medienkritisch kommentiert: Capurro, Rafael: Höhleneingänge – zur Kritik des platonischen Höhlengleichnisses als Metapher der Medienkritik; aufgerufen am 26. September 2015
27. ↑ ebd.
28. ↑ ebd.
29. ↑ ebd.; S. 358
30. ↑ ebd.; S. 368
31. ↑ Platon: a. a. O.; S. 273
32. ↑ ebd.; S. 375
33. ↑ vgl. Gaiser, Konrad: Das Höhlengleichnis: Thema und Variationen von Platon bis Dürrenmatt; in: Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur, Bd. 65, 1985; aufgerufen am 21. November 2015
34. ↑ So nutzt auch Umberto Eco die Tatsache der verloren gegangenen Schriften von Aristoteles und stellt in „Der Name der Rose“ die fiktive Geschichte der aristotelischen „Poetik“ dar, die vom Lachen handelt und von den Herrschenden jahrhundertelang geheim gehalten worden sei, weil diese das potentiell Revolutionäre des unvernünftig Leidenschaftlichen fürchteten. Sowohl in der fiktiven „Poetik“ wie auch dem von Sokrates überlieferten alternativen Höhlengleichnis wird die Differenz zwischen Platon und seinem Schüler deutlich. Aristoteles widmete sich dem lebendigen, leidenschaftlichen Menschen in einer gänzlich anderen Haltung als Platon.
35. ↑ Cicero, zit. n. Capurro: a. a. O.
36. ↑ Sontag, Susan: Über Fotografie; Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1980 (Original zuerst 1977); dies.: Das Leiden anderer betrachten; Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2005 (Original zuerst 2003)
37. ↑ Sontag, Susan: Über Fotografie; a. a. O., S. 24f.
38. ↑ ebd.; S. 26
39. ↑ ebd.; S. 57
40. ↑ ebd.; S. 29
41. ↑ ebd.; S. 105
42. ↑ ebd.; S. 107
43. ↑ ebd.; S. 108
44. ↑ Sontag, Susan: Das Leiden anderer betrachten; a. a. O., S. 16
45. ↑ ebd.; S. 88
46. ↑ ebd.; S. 50
47. ↑ ebd.; S. 113
48. ↑ ebd.; S. 133
49. ↑ ebd.; S. 93
50. ↑ ebd.; S. 125
51. ↑ ebd.; S. 88f.
52. ↑ So rief der Magnum-Bildband zum 11. September entsprechende Kontroversen hervor. Siehe dazu etwa: Frankfurter Allgemeine Zeitung: Drahtseilakt zwischen Kunst und Reportage – Fotos vom 11. September; aufgerufen am 29. November 2015
53. ↑ Sontag, Susan: Das Leiden anderer betrachten; a. a. O., S. 93
54. ↑ ebd.; S. 96
55. ↑ ebd.; S. 122
56. ↑ ebd.; S. 136
57. ↑ ebd.; S. 138
58. ↑ ebd.; S. 127f.
59. ↑ ebd.; S. 128
60. ↑ ebd.; S. 147