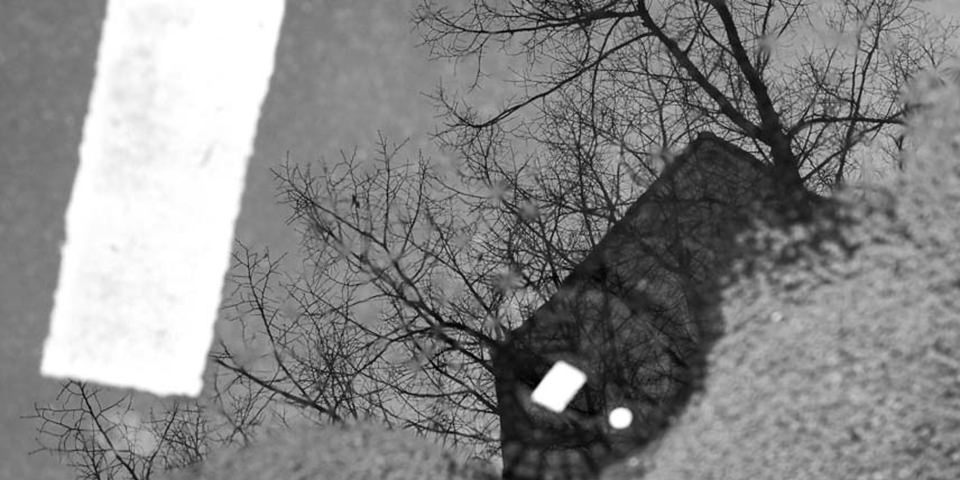Die Bilder und wir
I remember looking at life as a series of endless and exciting freeze frames. (Douglas Kirkland)
Wenn ich mit meiner Mutter über Fotografien sprach, so erwähnte sie immer ihre Tage der Flucht, die sie im kalten Frühjahr 1945 aus Schlesien nach Oberfranken führten. Unter ihren wenigen Habseligkeiten, die in einen Korb mit Bettwäsche, einen Koffer und eine Tasche passten, befanden sich die Alben mit den Familienfotos.
Dabei vergaß sie nie, mir zu sagen: Alles lässt sich im Leben ersetzen, die Fotos aber nicht. Die Bedeutung, die sie damit den Bildern ihres Lebens und Erinnerungen gab, konnte ich damals nicht verstehen. Heute, als ich in diesen Pandemie-Tagen der Isolation und des Rückzugs die Fotos meines bisherigen Lebens sichtete, erinnerte ich mich daran.
Jedoch, statt in Familienalben aufbewahrt, „stapeln“ sich heute meine „Erinnerungen“ digitalisiert im „Rechner“. Fast 40.000 Bilder, dreifach redundant gesichert oder für alle Ewigkeit unzerstörbar aufgehoben in der Cloud – für ihren Verlust müsste schon die Welt untergehen.
Doch was folgt daraus, heute, rund 60 Jahre später, für den Wert von Fotografien? Woran sollen sie erinnern? Worin liegt ihre Bedeutung, worin ihre Einzigartigkeit? Und woher kommt unser unstillbarer Drang, der zu diesen Bilderbergen führt?
Die Lust am Abbild und das Remake in der Nachbearbeitung
Die Zahl der täglich gemachten Bilder, ob „still“ oder „bewegt“, und die Millionen, die dann in den Datenbanken von Adobe oder Getty Images zu Stock-Medien werden, auf YouTube, Instagram und Facebook, übersteigt inzwischen unsere Vorstellungskraft.
Vierzig Milliarden Fotos zählt allein Instagram. Diese Bilderflut, ob in Form von Kunst, Werbung oder Selfie, kommt nicht über uns. Wir sind es, die diese Flut in Gang setzen, sie produzieren. Angetrieben von der Lust am Abbild, von uns selbst, einem Ereignis, einem glücklichen Augenblick oder einer Reise, vom Wunsch, sich zu erinnern.
Unsere Gier ist so groß, dass wir inzwischen die neuen Smartphones zuerst nach ihren Kamerafunktionen beurteilen. Und es ist nur konsequent, dass Apple das neueste iPhone mit seinen drei verschiedenen Objektiven auf der Telefonrückseite bewirbt.
Um Wahrheit, Objektivität und Wirklichkeit kann es nicht gehen. Denn eigentlich wissen wir als Bildproduzent*innen und -konsument*innen: Wenn wir fotografieren, „stagen“ wir, lassen „posen“, rücken zurecht. Wir führen Regie über die abzulichtenden „Objekte“ – mit unterschiedlichem Geschick.
Und nach dem Fotografieren beginnen wir zu retuschieren: Wir glätten, trimmen mit digitalen Filtern, Farben, Pinseln oder löschen die Aufnahmen, wenn sie uns nicht gefallen, um sie zu wiederholen. So folgt auf die Selfie-Session unmittelbar und unübersehbar die gemeinsame Begutachtung der Bildergebnisse. Mit zwei Fingern wird das Bild zum Vergrößern aufgezogen, um dann über Löschung oder Wiederholung zu entscheiden.
Und wir, die Älteren, erinnern uns, welche hektische Neugier Menschen erfasste, wenn Schwarzweißabzüge von ihnen herumgereicht wurden. Jeder wollte sie sehen, kommentieren, sich selbst im Spiegel der Bilder überprüfen. Professionelle Bildproduzent*innen, ob als Kunst-, Werbe- oder Nachrichtenfotograf*innen mögen das belächeln. Doch sie betreiben es selbst, diskreter und kultivierter – entweder bereits bei der Planung der Aufnahmen oder später in der Nachbearbeitung.
Denn niemand, ob Profi oder Amateur*in, gibt sich mit dem einfachen Abbild der Realität zufrieden. Wie auch die weitsichtige und kluge Susan Sontag schon 2003 anmerkte, „gehört es zu den Aufgaben der Fotografie, das gewöhnliche Aussehen der Dinge zu verschönern.“[1]
Fortschritt – was geschieht mit uns?
Die rasante technische Entwicklung der Fotografie hat auch uns verändert. Wir leben in Symbiose mit dem immer bereiten Telefon und seiner Kamera. Wir fotografieren so viel wie wir telefonieren, googlen, e-mailen, chatten und twittern. Und wir tun es quasi automatisch, als ob unser Dasein ohne das virtuelle, mediale Abbild nicht existent sei. Wie sehr sich damit die öffentliche gesellschaftliche Choreografie verändert hat, stellte der heute über 80-jährige amerikanische Straßenfotograf Joel Meyerowitz rückblickend in einem Gespräch fest:
So the street had a kind of physical, visual dynamic. [But now] what you see on the street, in effect, are all these phones. On every photograph there’s going to be a dozen phones showing up. So the pictures are subverted.
Suddenly it looks like you’re not just making a picture of your time, but you’re making a commentary on the use of phones. And so that adds a familiarity to every single picture, and it derails certain emotional momentary observations that might be the heart of the picture because now you see eleven phones.[2]
Er vermisst auf seinen Fotografien die Interaktion zwischen Menschen. Es dominiert der vereinzelnde Blick nach unten auf das Display ihrer Geräte, die Abwendung vom gemeinsam genutzten, öffentlichen Raum. Wie die soziale ist auch unsere individuelle, körperliche Haltung mit den allzeit verfügbaren Apparaten eine andere geworden.
Anders als Sucherkameras, die vor den Augen oder dem Bauch eng am Körper gehalten verwendet wurden, strecken wir etwa Smartphones zum Fotografieren mit den Armen aus und blicken dabei auf das Display. Wir machen uns groß – und werden damit fast unübersehbar zum Mittelpunkt der Aktion, ganz wie zum Anbeginn der Fotografie.
Schon Vilém Flusser schrieb 1983 in seinen Überlegungen zur Fotografie über die Haltung der Fotograf*innen, die er mit dem „Lauern“ von Jäger*innen verglich.[3] „Die Fotogeste ist eine Jagdbewegung, bei der Fotograf und Apparat zu einer unteilbaren Funktion verfließen.“[4] Und es ist schon verwunderlich, wie bereitwillig Fotograf*innen, ob in der Werbung oder auf dem „Schlachtfeld“, ihre Tätigkeit als „shooting“ und das Bild dann als „nice shot“ bezeichnen.
Zusammen mit der Haltungsänderung hat sich unsere Wahrnehmungskultur verändert. Jeder kennt es: Ein Konzert beginnt, ein*e Künstler*in tritt auf. Dies ist der Augenblick, in dem zwischen unsere Aufmerksamkeit als Hörer*in sowie Zuschauer*in und die Darbietung das Display tritt. Unsere Sinne und Blicke heften sich an den Bildschirm, sie werden auf den Bildausschnitt unserer Geräte beschnitten.
Oft werden diese Augenblicke neu inszeniert, indem viele sich schon während der Veranstaltung selbst als Selfie in das Konzertgeschehen einbauen, dann das Ergebnis begutachten und online auf ihren Social-Media-Kanälen teilen. Aus dem realen, analogen Vorgang machen wir einen virtuellen, digitalen. Das Konzert oder die Veranstaltung wird zur Bühne der eigenen Präsentation – online, einem Ort unserer Lust am Hedonismus.
Unser niederdrückendes Gefühl der Flüchtigkeit aller Dinge hat sich nur noch verstärkt, seit uns die Kamera die Möglichkeit gegeben hat, den flüchtigen Augenblick zu fixieren. […], wir konsumieren Bilder mit wachsender Geschwindigkeit, und […] Bilder konsumieren die Realität.[5]

Flucht von Schweidnitz nach Oberfranken, Frühjahr 1945, meine ältere Schwester, links die Großmutter und Mutter, rechts Begleiter*innen
So viele Bilder – was wir in ihnen suchen
Doch was steckt hinter dieser lustvollen, medialen Reproduktion unserer Welt, dem „Recycling der Wirklichkeit“ (Susan Sontag), die keine Mühen und Kosten scheut? Woher kommt der schier unstillbaren Hunger nach Bildern, die die Speicher unserer Geräte füllen, sodass der Verkauf von zusätzlichem digitalen Speicherraum in der Cloud zum riesigen Geschäft wurde?
Wir sind umgeben von Bilderfluten, die den öffentlichen Raum mit immer größeren Displays besetzen. Nach Susan Sontag liegt der Grund dafür „[…] in der Logik des Konsums selbst. Konsumieren heißt verbrennen, verbrauchen – und beinhaltet damit zugleich das Streben nach Ergänzung. Indem wir Bilder machen und sie konsumieren, provozieren wir in uns das Bedürfnis nach mehr und mehr Bildern.“[6]
Für sie ist die Überproduktion von Bildern das notwendige Pendant zur kapitalistisch angetriebenen Überflussproduktion von Waren. Auch wenn die Fotografie darin eingebettet ist, – ich möchte nicht zwischen der professioneller Fotografie und der von Amateur*innen unterscheiden – und den Konsum der Ware Bild wie alle anderen Waren beständig anfeuert, vermute ich eine autonome, anthropologische Motivation, die auf die ewige Lust am Abbilden und Darstellen verweist.
Vielleicht haben wir zum (Über-)Leben schon immer Figuren, Zeichnungen oder Darstellungen – heute sind es die Fotos – gebraucht: um zu reflektieren und uns zu erinnern, um gesellschaftliche Zusammenhänge zu begreifen und zu gestalten, um uns unserer Existenz zu versichern.
So bauen wir zum Verständnis der Realität Modelle, inszenieren Bilder für das Theater. Wir haben Steinmetz*innen für Denkmäler oder Sarkophage, Maler*innen oder heute Fotograf*innen. Die archäologischen Museen sind im Grunde Bildersammlungen, die uns mit ihren Exponaten bis in die früheste uns bekannte Menschheitsgeschichte führen. Wir staunen über die ersten Höhlenzeichnungen und Menschenfiguren, über Gesichter, gigantische Mosaikbilder, Reliefs, erotische und sexuelle Darstellungen.
Wenn für Susan Sontag die Fotografie „eine Methode zum Einfangen einer als widerspenstig und unzugänglich empfundenen Realität“[7] ist, so gilt das sicherlich für Abbildungen aller Art, die die gesamte Menschheitsgeschichte begleiten: Wir wollen verstehen, wollen hinter das Sichtbare schauen, dem wir misstrauen, als ob es eine andere, bedeutendere Wahrheit vor uns verbirgt.
Wir wollen es anhalten, um es immer und immer wieder untersuchen zu können. Oder tun wir es vielleicht, weil wir wissen: „the future will erase the present“ – die Zukunft wird die Gegenwart tilgen?![8]
Zum Verstehen gesellt sich als weiteres, vielleicht das wichtigere Bedürfnis an Bildern: die Suche nach Stimulanzien. Allein die Zahlen über den Konsum erotischer bzw. pornografischer Bilder, bewegt und unbewegt, gerechnet in Internet-Klicks, als Zeit oder in Geld, beweisen: Neben dem Verstehen brauchen die Menschen auch Bilder für ihren Gefühlshaushalt. So gesehen ist heute nicht das Bedürfnis am Bild neu, sondern die Überproduktion, die Flut und Überreizung.
Die wachsende Menge der Bilder, ihre technische Größe in der Projektion oder Präsentation, ob drei- oder zweidimensional, ob leuchtend oder blinkend, zeigt uns: Eine Entgrenzung ist im Gange, eine Verdoppelung oder sogar Verdreifachung unserer Realität und Träume, die sich in atemberaubender Weise potenziert.
Die Bilder auf Instagram – vom „Sieg der Darstellung über das Dargestellte“?
Ungefähr 80 Millionen Bilder werden täglich auf Instagram geladen – Tendenz steigend – und einer fast unbegrenzten Welt-Öffentlichkeit zur Begutachtung präsentiert. Eine erstaunliche Entwicklung, denn mit Instagram ist ein Publikationsmedium herangewachsen, das die oft willkürliche Grenzziehung zwischen Professionellen, Künstler*innen und Hobbyfotograf*innen ignoriert.
Neben World-Press-Photo-Gewinner*innen (etwa John Stanmeyer), renommierten Straßenfotograf*innen (wie John Meyrowitz), Magnum-Fotograf*innen und so weiter tummeln sich dort alle, die irgendwie Bilder machen – nebeneinander und ohne Berührungsängste – auf einer gemeinsamen Timeline in einem endlosen Bilderstrom. Ein demokratischer Idealzustand etwa? Ist Instagram ein Medium der Freiheit, das fast ohne Zensur auskommt? Was hätten Susan Sontag und Roland Barthes zu dieser Entwicklung gesagt?
Doch auffällig an dieser Bilderflut ist, dass mit dem exponentiellen Wachstum des „content“ die Bedeutung von Inhalt und Kontext sich umgekehrt proportional zu verflüchtigen scheint. Zu viele Fotograf*innen verzichten darauf, die von ihnen fotografierten Personen nach Namen oder Lebensumständen zu fragen und von einer Begegnung zu berichten. Damit schaffen sie Bühnen nach ihren Vorstellungen und machen andere Personen zu Statist*innen ihrer Visionen. Vielleicht war es das, was Adorno damals meinte, als er vom „Sieg der Darstellung über das Dargestellte“ schrieb.
Doch mit der Bilderflut wächst das Bedürfnis nach „Bild-Stille“, nach dem Anhalten des Bilderstroms. Menschen beginnen, sich gegen die Gewalt der Definitionsmacht, die den Bilderfluten innewohnt, zu wehren. Sie fragen nach dem Kontext und der Entstehung von Bildern. Und mit der Erfahrung ihrer grenzenlosen Manipulierbarkeit schwindet die Gewissheit, Bilder als Abbilder der Realität lesen zu können.
Lebensspuren – Entdeckungen
In Wim Wenders’ Film „Don’t come knocking“ von 2005 sagt Sky zu ihrem Vater, als sie ihm zum ersten Mal begegnet: „Ich kenne jedes Bild von dir, die alten Fotos. Ich habe sie immer und immer wieder angesehen. Ich habe mit den Fingern die Konturen deines Gesichtes nachgezeichnet.“
Von Fotografien geht ein eigentümlicher Reiz aus, als ob wir im Betrachten wie durch eine Zeitschleuse in die Vergangenheit eintauchen könnten, die dargestellten Protagonist*innen berühren könnten. Obwohl sie als geronnenes Leben, als „freeze frames“, Spuren des Lebens enthalten, die über das Davor und Danach des fotografierten Augenblicks hinausführen, bleiben sie nur ein Abbild. Wir können sie nicht berühren, sondern nur durch geduldiges Betrachten entdecken und lesen.
Ein anderes Beispiel aus der Filmgeschichte: Im großartigen Film „Blow up“ aus dem Jahr 1966 von Michelangelo Antonioni steht ein Londoner Modefotograf (David Hemmings) im Mittelpunkt. Gelangweilt von den Studioaufnahmen mit Modellen und verfolgt von Groupies, beginnt er, in der Straßenfotografie nach neuem Sinn zu suchen.
Als er in einem Park eher zufällig einen Mann und eine Frau fotografiert, wird er Zeuge eines Mordes. Denn nachdem er die Negative entwickelt hatte, bleibt er nach dem Vergrößern am entsetzten Blick der Frau (Vanessa Redgrave) hängen. Er folgt daher mit weiteren Vergrößerungen ihrem Blick auf einen Busch, wo er dann eine Hand mit Pistole erkennen kann.
Als er die anderen, auf den Moment folgenden Fotos entwickelt – auf ihnen ist die Frau allein zu sehen –, entdeckt er auf den Vergrößerungen im Gebüsch die Umrisse eines Körpers. Um sich zu vergewissern, geht er in den Park zu diesem Busch und sieht seine Vermutungen bestätigt: Er findet dort den nun toten Mann, mit dem die Frau zuvor zusammen war.
Auch wenn der Film surrealistisch endet – bei einem weiteren Besuch im Park ist die Leiche verschwunden, eine Gruppe von Zirkusleuten spielt neben dem Park Tennis ohne Bälle – zeigt uns Antonioni die Kraft des Blicks, des konzentrierten Sehens.
Mit einem anderen Beispiel möchte ich an das berühmte, ikonografische Foto „Auf dem Berliner Reichstag, 2. Mai 1945“, aufgenommen von Jewgeni Chaldej, erinnern.[9] Es zeigt zwei Rotarmisten auf dem Reichstagsgebäude, die eine Sowjetflagge hissen. Obwohl das Foto inszeniert wurde, offenbart das Original ein Stück unliebsame Wahrheit, die das politische Klischee von der unbescholtenen Roten Armee konterkariert:
An den Handgelenken eines der Soldaten befinden sich zwei Armbanduhren. Ein Detail, was auf Plünderungen und Raub durch sowjetische Soldaten bei der Eroberung Berlins schließen lässt. Neben der Dramatisierung des Fotos – etwa durch hinzugefügte Rauchschwaden – wurde dann eine der Uhren auch entfernt. Schon damals kein großes Kunststück.
Viele von uns Fotograf*innen haben sicherlich auch wie ich Entdeckungen auf Bildern gemacht. Wir haben Lebensspuren in Bildern gefunden, die eine Idylle oder das Trugbild störten. Für eine Ausstellung hatte ich historische Fotografien aus der Geschichte eines oberfränkischen Dorfes zusammengetragen.
Viel dörfliche Idylle sprach aus ihnen. Aber auch das harte Leben: Frauen mit Kropf (Jodmangel in der Ernährung), kleine dunkle Häuschen, schwere Arbeiten in der Landwirtschaft. Dann gab es eine Überraschung, die diese Idylle störte. Beim Vergrößern eines Bildes – zu sehen war ein Wirtshaus mit einem jungen Baum davor – sah ich auf der Umzäunung des Baumes ein eisernes Hakenkreuz.
Damit war klar: Der Baum war eine Hitlerlinde, gepflanzt vor dem Dorfwirtshaus. Unter welchen Umständen das Hakenkreuz dort angebracht wurde, habe ich nicht verfolgen können. Doch das Foto wird dadurch zum Dokument einer Dorfgeschichte, es zeigt uns gegensätzliche, aber komplementäre Seiten.
Täuschungen – trügerische Bilder
Anders verhält es sich mit Bildern, die – offen oder versteckt – nicht sind, was sie behaupten. Die mit ihrer Botschaft unseren Blick (ab-)lenken wollen; ob in der Werbung, der Politik oder in der Kunstfotografie. Ich nenne sie trügerische Bilder.
Am einfachsten verhält es sich mit dem in Druck- und Online-Medien immer häufiger verwendeten „Symbolbild“. Da es laut offizieller Definition eine Darstellung ist, die nicht den tatsächlichen Sachverhalt darstellt, also nicht den Vorgang zeigt, der beschrieben wird, ist es bereits schon per Definition eine Täuschung und unwahr. Zu diskutieren wäre dabei eher die mediale Ethik und Moral, die Absicht und Wirkung dieser Medienpraxis.
Etwas schwieriger wird es, wenn das Bild Authentizität oder Echtheit vortäuscht, wenn es beispielsweise für einen Oberbürgermeister-Kandidaten wirbt, einen blassen Jungpolitiker, der als Macher „verkauft“ wird, als zupackender Mann des Volkes. Die Attribute seiner Präsentation auf den Plakaten: ein hochgestellter Mantelkragen, umringt von fragenden, wohlwollenden Bürger*innen, ihnen natürlich Rede und Antwort stehend.
Diffiziler wird es, wenn Authentizität und Tiefe mit einer dogmatisch überhöhten Schwarzweißfotografie behauptet wird. Als läge bereits in der Methode, nämlich dem Verzicht auf Farbigkeit, schon der Schlüssel zum Verstehen einer verborgenen Realität. Dieser Art von Bildern begegnen wir oft in der Straßenfotografie.
Wenn diese Fotograf*innen nicht gerade humorvoll die Komik oder auch Tragik des Alltags ablichten, fokussieren sie oft auf Strukturen von Licht und Schatten und auf Menschen, die sich darin bewegen. (Eine Ausnahme sind dabei vielleicht die Schwarzweißarbeiten von Alan Schaller, der das zur Perfektion getrieben hat.) Vielen haftet ein voyeuristischer Zug an, ein Desinteresse am Ort des Geschehens, an der Identität der Abgebildeten. Mit extremen Vignettierungen, mit Titeln oder Lyrik-Zitaten wird zusätzlich die Dramatisierung der Bildaussage versucht.
Ähnlich verhält es sich mit Bildern, die Stimmungen reanimieren wollen. Das inszenierte Paris-Foto von Robert Doisneau – ein sich küssendes Paar, „Le Baiser de l’Hôtel de Ville Paris“ von 1950[10], das oft als dokumentarisch missverstanden wird – ist heute in seiner Wiederholung – ob in Paris, Rom oder Prag – zwangsläufig „falsch“. Es befriedigt allenfalls nostalgische Sehnsüchte oder den modischen Retrolook.
Weitere Beispiele finden wir in den Schwarzweißfotografien aus dem Milieu des Jazz. Auch dabei wiederholen sich Stil und Motive der 50er und 60er Jahre, wie wir sie von den Blue-Note-Plattencovern kennen.[11] Jedoch ist das Milieu der Clubs und der Nacht heute ein anderes. Beide Male sind die evozierten Stimmungen trügerisch, da sie Tiefe und Sinnhaftigkeit vorgeben, die jedoch nicht existieren.
Aber wie immer gibt es auch hier den künstlerischen Kontrapunkt, das Spiel mit Wahrheit und dem Schein, wie es beispielhaft der kanadische Fotograf Jeff Wall praktiziert. Seine scheinbar dokumentarischen Bilder sind in tagelanger Arbeit inszeniert, mit Darsteller*innen und Requisiten arrangiert, um eine Botschaft aufzunehmen, die erst durch Hinsehen und Nachdenken entschlüsselt werden kann.
So zeigt eines seiner bekanntesten Bilder mit dem Titel „Mimic“ von 1982[12] eine Straße in Vancouver, auf der drei Menschen sich auf einem Bürgersteig begegnen. Eine scheinbare Banalität, enthielte das Foto nicht auch die Darstellung von versteckter Diskriminierung. Denn die Geste des „weißen“ Mannes – er zieht mit dem Finger die rechte Augenbraue nach oben – ist eine rassistische Anspielung auf den entgegenkommenden Passanten mit asiatischem Gesicht.
Bildgeschichten – Wahrheiten und das „Storytelling“
Um Bildern Authentizität und Vitalität zu geben, wird Fotografie heute oft mit dem Konzept des Storytelling verbunden. Es entstammt der Waren- und Verkaufswelt. Mit einem „Narrativ“ soll Dingen Leben eingehaucht werden. Denn, so das Kalkül der Marktstrateg*innen: Das Parfüm, der Designerstuhl oder das Modekleid verkaufen sich besser, wenn ihr Image aus einer Geschichte besteht.
Emotionen und Dramaturgie schaffen Aufmerksamkeit und Bindung, Belangloses und Beliebiges erhält Bedeutung. Übertragen auf die Fotografie heißt das: Im Gegensatz zum Film steht nur ein Einzelbild zur Verfügung, um die Botschaft und die Geschichte zu etablieren. Das hat Folgen für die Komposition, die Farben und den Inhalt.
Die Betrachter*innen sollen das Bild in Bewegung setzen, seine Geschichte des Inhalts, der Situation und der Personen erfühlen. Fotografien, die sich diesem Konzept verschreiben, sind oft kryptisch und verrätselt, als ob mit ihrem behaupteten Geheimnis bereits eine Geschichte in Gang käme.
Häufig korrespondiert das mit fehlender Aufmerksamkeit für den Kontext des Bildes, mit fehlender Geduld und Vertiefung. Wir sehen das, wenn wir uns die lange vor diesem Storytelling-Hype entstandenen Bilder von Vivian Maier (1926–2009) anschauen. Sie wollte nicht als Fotografin gelten, sondern nur ihrer unendlichen Neugier folgen.
Gleiches erleben wir beim Betrachten der Fotos von Robert Frank aus seiner Reihe „The Americans“. Die Geschichten auf den Bildern und ihre gefühlsmäßige Wirkung entstehen nicht aus dem Kalkül oder der Verrätselung. Sie entspringen dem tiefen Eintauchen von Robert Frank in den amerikanischen Alltag. Seinen Fotos gelingt die Verdichtung von Augenblicken zu ikonografischen Bildern – und jedes für sich öffnet ein Fenster in eine Welt voller Geschichten.
Das Bild – seine Seele und der „helle Schatten“
Als ich in einer türkischen Kleinstadt aus einem Café heraus auf die Straße fotografierte, kam ein junger Mann auf mich zu und fragte: „Hangi ruh ile cekiyorsun?“ Also: „Mit welcher Seele, welchem Gefühl fotografieren Sie?“ Die Frage überraschte mich sehr, sie war ungewöhnlich – und schön. Denn üblicherweise kommt die Neugier so daher: Mit welchem Kameramodell und für wen fotografieren Sie? Hierbei ging es aber um das innere Motiv, das dem Bild die Seele gibt. Ja, manche Bilder haben eine Seele.
Ich begegnete dieser Frage nach der Seele eines Bildes, seiner Lebendigkeit, wieder bei der Lektüre von Roland Barthes. Er spricht beim Betrachten des Fotos seiner geliebten verstorbenen Mutter von „Ausdruck“ als Äußerung von Wahrheit.
Und wenn es einem Foto nicht gelingt, diesen Ausdruck zu zeigen, dann bleibt der Körper schattenlos […] und versteht [der Fotograf] es nicht, sei es aus Mangel an Talent, sei es durch missliche Umstände, der durchsichtigen Seele ihren hellen Schatten zu geben, so bleibt das Subjekt für immer tot.[13]
Robert Frank, der mit seiner „little camera“ (Jack Kerouac) durch Amerika reiste, fand genau diese „Schatten der durchsichtigen Seele“ und formte sie zu einem aufwühlenden Gedicht: „He sucked a sad poem right out of America on to film, taking rank among the tragic poets of the world.“[14]
So geschieht das Wunder, dass aus dem Universum der Bilder manche von ihnen beim Betrachten zu sprechen beginnen und tiefe Emotionen auslösen. Doch in der Bilderflut und ihrer Bearbeitung erleben wir heute, dass „[…] die Gesellschaft darauf bedacht [ist], die Fotografie zur Vernunft zu bringen, die Verrücktheit zu bändigen, die unablässig im Gesicht des Betrachters auszubrechen droht.“[15]
Und je mehr wir die wachsende Bilderflut, deren Verrücktheiten und Ambiguitäten „dem zivilisierten Code“ unterwerfen und daraus perfekte Trugbilder machen, beginnt die „Darstellung, über das Dargestellte zu siegen“.[16]
Das Bild – Erinnerung und „Beglaubigung von Präsenz“
Als meine Großmutter ihr Ende nahen fühlte, bat sie meine Mutter darum, gemeinsam mit ihr das Fotoalbum der Familie anzuschauen. Es war exakt die Nacht vor ihrem Tod. Worüber beide sprachen, erfuhr ich nicht, ich fragte auch nicht danach. Obwohl wir sie bei uns in der Wohnung hatten, wollte meine Mutter nicht, dass ich das Sterben meiner Großmutter begleite.
Heute denke ich daran und frage mich: Betrachtete sie das Foto, auf dem ich nach meiner Geburt in die Flüchtlingswohnung – mein erstes Zuhause – gebracht wurde? Oder war es das Foto, das sie mit ihren drei Enkelkindern zeigt? Vielleicht nahm sie das Bild mit ihrem Mann zur Hand, mit dem sie so gern auf die Schneekoppe wanderte und dessen Leben zu Ende ging, ohne dass sie bei ihm sein konnte.
Oder hielt sie gar inne über dem Bild von der Flucht? Das Bild, das sie auf dem Bahnhof zeigt, zusammen mit meiner Schwester, meiner Mutter, Begleiter*innen und einigen Habseligkeiten, die sie tragen konnten. In diesem Gepäck mussten sich auch die Fotoalben befunden haben, die sie nun mit ihrer Tochter durchblätterte.
Was mögen ihre Kommentare zu den Fotografien gewesen sein? Was empfand sie beim Betrachten der Dokumente eines langen und beschwerlichen bäuerlichen Lebens in Schlesien, der Flucht und des Versuchs eines Neuanfangs nach dem Krieg?
Ich vermute, die Bilder begannen in diesen letzten Augenblicken zu sprechen, ihre Seele zu zeigen. Sie wurden zu „einer Beglaubigung von Präsenz“[17], derer man sich in diesen Stunden versichern möchte. War das alles wahr, wirklich?
Quellen und Anmerkungen
1. ↑ Susan Sontag: „Das Leiden der anderen betrachten“, S. 94
2. ↑ Interview von Jim Casper mit Joel Meyerowitz: „Ready for Surprise“, 2020
3. ↑ Vilém Flusser, „Für eine Philosophie der Fotografie“, 1983, S. 31
4. ↑ ebd., S. 37
5. ↑ Susan Sontag: „Das Leiden der anderen betrachten“, S. 171
6. ↑ Susan Sontag: „Über Fotografie“, S. 171
7. ↑ ebd., S. 156
8. ↑ Louise Glück: „Proofs & Theories. Essays on Poetry“, 1994, S. 27
9. ↑ Ernst Volland: Das manipulierte Foto
10. ↑ Artsy: Robert Doisneau, Le baiser de l’Hôtel de Ville, 1950
11. ↑ siehe auch William Claxton: „Jazz seen“
12. ↑ Tate: Jeff Wall: room guide, room 3
13. ↑ Roland Barthes, „Die helle Kammer“, S. 121
14. ↑ Jack Kerouac in der Einleitung zu „The Americans“ von Robert Frank
15. ↑ Roland Barthes, „Die helle Kammer“, S. 128
16. ↑ Theodor W. Adorno: „Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben“, S. 160
17. ↑ Roland Barthes, „Die helle Kammer“, S. 97