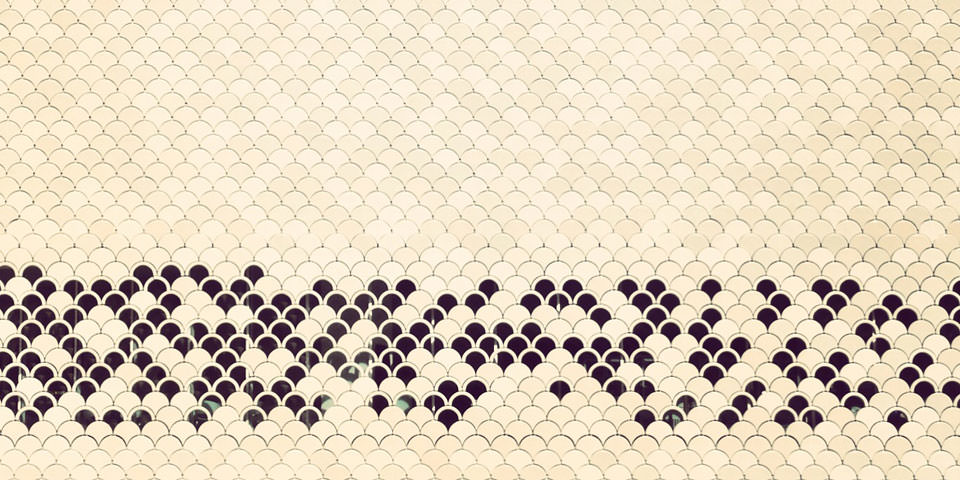Filterhölle und Lifestyleoase? Fotografie auf Instagram
Über Instagram und Co. zu schimpfen, ist keine Kunst. Am sozialen Netzwerk Instagram kann Kunstinteressierte alles stören. Das kleine Format, in dem man sich Fotos auf dem Bildschirm des Smartphones anschauen soll, die geringe Auflösung der Bilder, überhaupt ist alles nur digital verfügbar und dann sind da auch noch 500 Millionen andere Nutzer, die mehr als 95 Millionen Bilder und Videos täglich teilen und über vier Milliarden Mal mit dem Daumen bestätigen, dass ihnen gefällt, was in Höchstgeschwindigkeit an ihnen vorbeirauscht.
Selfies und Sonnenuntergänge hauptsächlich, wie Kritiken vermuten: Instagram ist eine Filterhölle und Lifestyleoase. 21 Minuten verbringt der durchschnittliche Nutzer am Tag in der App, 14 Mal lädt er sie neu. Eine bekannte Ausnahme gibt es: Hans Ulrich Obrist, der größte Starkurator der westlichen Welt, checkt nach eigener Aussage 20 Mal pro Stunde Instagram, seinen wichtigsten Informationskanal.
Um die Qualität kann es also nur schlecht bestellt sein, oder? Jeder Mensch ist Fotograf*in, auf Fotografie und Kommunikation kommt es an. Das haben wir alle schon einmal gehört. So ähnlich zumindest. Ein Fotograf wie Martin Parr macht Tausende Fotos jedes Jahr, 15.000 zieht er probeweise ab. Wenn darunter zehn gute Bilder sind, war es für ihn ein gutes Jahr, sagte er einmal im Interview. Kurz gerechnet, Dreisatz angewendet, das macht bei 95 Millionen Bildern, sagt der Taschenrechner, ca. 63.000 gute Bilder. Ganz so viele werden es nicht sein, aber es bleibt zu vermuten, dass 63, 630 oder vielleicht sogar 6.300 und mehr Fotos täglich hochgeladen werden, die man als irgendwie interessant ansehen könnte.
Natürlich ist nicht jeder ein Martin Parr. Ganz im Gegenteil sogar. Auf Instagram tummeln sich A- bis Z-Promis, Modeblogger*innen, Rockstars, Autor*innen uvm., die durch die App zu Fotograf*innen wurden und ihren Lebensunterhalt damit bestreiten. Selena Gomez, Taylor Swift, Beyoncé, Kim Kardashian und Justin Bieber, der mit Instagram eine On-Off-Beziehung führt, sind die Top-Accounts. In Deutschland sind es Fußballer, Youtube-Stars und die tanzenden Zwillinge Lisa und Lena. Nach Fotograf*innen muss man ein wenig suchen, in wenigen Fällen wird man fündig, vor allem dann nicht, wenn es um Fotografie aus Deutschland geht.
Juergen Teller? Nicht da. Thomas Struth? Nein. Wolfgang Tillmans? Ist da. Andreas Gursky? Fehlanzeige. Heidi Specker? Ja, mit 239 Followern. F. C. Gundlach? Ist da, folgt 16 Accounts, ist aber ansonsten inaktiv. Christoph Bangert? Nicht da. Denn seine Online-Persönlichkeit hat vor mehr als zwei Jahren Selbstmord begangen, kurz bevor sein Buch War Porn  erschienen ist. Auf die Frage nach den Gründen antwortet er:
erschienen ist. Auf die Frage nach den Gründen antwortet er:
Wir haben immer noch nicht kapiert, dass Bilder Daten sind. Und dass Daten gleichzusetzen sind mit Geld. Zudem handelt es sich beim Hochladen von Bildern auf Instagram, Facebook und Twitter auch um eine klassische Veröffentlichung. Warum sollte ich meine Bilder – alles, was ich habe, mein einziges Talent, mein Schweiß und Blut – in einem sozialen Netzwerk teilen, das sich überhaupt nicht für Fotografie interessiert und das mich in Klicks, Likes und Exposure bezahlt?
International sieht es schon ganz anders aus, da sorgt sich offenbar niemand um kostenlose Veröffentlichungen. Alec Soth, Steve McCurry, David Guttenfelder, Ryan McGinley, Martin Parr, Adam Broomberg, Bruce Gilden und Phil Toledano – die Liste ließe sich noch eine ganze Weile ergänzen – sind alle selbst aktiv auf Instagram oder lassen ihr Studio den Account für sich beispielsweise mit Bildern aus dem Archiv bespielen. Instagram als Verlängerung der Webseite, als Ich-PR, kann man machen, es geht aber auch anders.
Stephen Shore ist der Vorzeige-Fotograf auf Instagram. Er postet pro Tag ein Foto, mittlerweile sind es über 800, und nennt Instagram seit einiger Zeit sein Hauptwerk. Dafür muss er sich gelegentlich belächeln und Wutausbrüche in den Kommentaren über sich ergehen lassen. Denn nicht alle wollen oder können verstehen, dass der Stephen Shore, der neben William Eggleston und Joel Meyerowitz einer der Mitbegründer der New Color Photography in Amerika war, dessen Fotobücher Uncommon Places  und American Surfaces
und American Surfaces  in so gut wie jedem Bücherregal stehen, jetzt ein soziales Netzwerk nutzt, um seine neuesten Arbeiten zu zeigen. Shore stört das nicht weiter. Er liest die Kommentare, wie er sagt, immer, in Diskussionen à la „Ist das Kunst oder kann das weg?“ schaltet er sich selten ein. Für Komplimente bedankt er sich höflich, gern auch mal nur mit Emoticons, auf Fragen antwortet er.
in so gut wie jedem Bücherregal stehen, jetzt ein soziales Netzwerk nutzt, um seine neuesten Arbeiten zu zeigen. Shore stört das nicht weiter. Er liest die Kommentare, wie er sagt, immer, in Diskussionen à la „Ist das Kunst oder kann das weg?“ schaltet er sich selten ein. Für Komplimente bedankt er sich höflich, gern auch mal nur mit Emoticons, auf Fragen antwortet er.
Kurz, Stephen Shore, der in den letzten Jahrzehnten die Geschichte der Fotografie mitgeschrieben hat, fügt sich den Gepflogenheiten des sozialen Netzwerks. Deshalb postet er auch stetig ein Foto pro Tag, möglichst zeitnah zum Zeitpunkt der Aufnahme, immer das beste, wie man das eben so macht, wenn man weiß, wie Instagram funktioniert. Häufig fotografiert er, wenn er mit seinen Hunden Gassi geht, deshalb wandert sein Blick oft nach unten, er hält verschiedene Strukturen am Boden fest, sein Blick fällt auf Büsche, Sträucher und Bäume oder er schaut nach oben in den Himmel.
Der Garten seiner Frau Ginger ist ein Dauerthema, die Blumen, die Hunde, er fotografiert auf Reisen und wenn er beruflich unterwegs ist. Eigentlich ist alles wie immer, wie damals, als er in den 70er Jahren durch Amerika reiste und jedes Essen, jede Toilette, jedes Bett und jede Person fotografierte, so wie es ein Tourist mit seiner Kamera auch getan hätte. Heute fotografiert er, was in seinem Alltag passiert, was er sieht, was ihn emotional berührt, seine Frau, sein Sohn, dessen Freundin und das so, wie es alle tun, die mit ihren Smartphones visuelle Notizen im Alltag machen, um sie auf Instagram zu teilen. Stephen Shore bearbeitet die Bilder nicht, er verwendet keine Filter.
Instagram gibt es seit über sechs Jahren. Anfangs dachten die Nutzer, es handele sich um eine App, die Filter zur Bearbeitung von Fotos zur Verfügung stellt, damit sie aussehen wie Polaroids und sie in eine andere Zeit zurückversetzen. Early Bird, Toaster, Inkwell, Sutro, X-Pro II hießen die Filter damals und es gibt sie wie – um nur einige zu nennen – Valencia, Hefe und Reyes fast alle immer noch.
Am Ende des letzten Jahres wollte eine Umfrage belegen, dass Eltern ihre Kinder nach Filtern von Instagram benennen. Beliebte Kindernamen waren Ludwig, Amaro, Hudson, Kelvin, Willow, Reyes und einige mehr. Und kürzlich haben Forscher der amerikanischen Universitäten Harvard und Vermont 44.000 Posts von 166 Profilen auf Instagram untersucht und herausgefunden, dass Menschen, die zu Depressionen neigen, Filter wie Inkwell, Crema, Willow und Reyes verwenden, also dunkle und kühle Filter mit Blautönen.
Trotz Studien, Umfragen und dem Vorurteil, Instagram sei eine Filterhölle, in der Sepia fließt, sind Vintagefilter schon seit einigen Jahren kein Thema mehr. Es wird auf die Kamera des Smartphones zurückgegriffen, um zu fotografieren, dann werden die Aufnahmen in Apps wie Snapseed, Lightroom, Afterlight, Vsco und Skrwt bearbeitet und auf Instagram gepostet. Wenn unter professionellen Instagrammern überhaupt noch mit dem Smartphone gearbeitet wird.
Man kann aber auch ganz entgegen der Logik des sozialen Netzwerks agieren, wie es der Kritiker, Autor und Fotograf Teju Cole macht, der analog fotografiert, scannt und zeitversetzt postet, manchmal Monate später. Instant passiert allgemein nicht mehr viel, da die Qualität der Bilder stimmen soll und muss und man sich deshalb Zeit für Auswahl und Bearbeitung nimmt. Die Momente spielen sich hauptsächlich in den Stories auf Instagram ab, die wie auch auf Snapchat nach 24 Stunden automatisch gelöscht werden.
Und da man generell nicht weiß, wie es um die Zukunft von Instagram bestellt ist – man denke nur an Myspace, StudiVZ oder die ganzen Apps, die fast täglich aus dem Boden schießen wie Polaroid Swing und Phhhoto, um zu bleiben und Instagram Konkurrenz zu machen oder gleich wieder vergessen zu werden – kam Stephen Shore gemeinsam mit William Boling, dem Verleger von Fall Line Press in Atlanta, auf die Idee, ausgewählte Fotos in die analoge Welt zu überführen.
Inzwischen ist die zweite Ausgabe von „Documentum“ unter dem Titel Pictures & Words erschienen. Es geht also um das Zusammenspiel von Worten und Bildern auf Instagram, um Formate wie den Instaessay, um die Nutzung als Notiz- und Tagebuch, wie beispielsweise bei Teju Cole. „Documentum“ ist kein klassisches Fotobuch, sondern eine Zeitung, vergänglich und nicht zu wertvoll, wie die Bilder in den sozialen Medien.
Museen, Kultureinrichtungen, Galerien und Magazine bieten Künstschaffenden an, ihre Accounts für ein paar Tage oder eine ganze Woche zu übernehmen. So ein Takeover ist eine klassische Win-Win-Situation: Der Kanal füllt sich eine Zeitlang wie von selbst, der Inhalt dürfte die Follower interessieren und sorgt für Abwechslung, man wird gesehen und promotet sich und das Museum, die Galerie oder das Magazin etc.
Als Stephen Shore beispielsweise anlässlich seiner Retrospektive im C/O Berlin war, hat er den Account des Ausstellungshauses für Fotografie mit seinen Bildern von der Eröffnung bespielt. Alec Soth wurde einem Tag lang die Verantwortung für den Snapchat-Account des Time Magazine übertragen, als es dort losging. Er lief umher und nahm eine Reihe filmischer Portraits auf, Zehn-Sekunden-Sequenzen, die an die „Screen Tests“ von Andy Warhol erinnerten, die Mitte der 60er Jahre in der Factory entstanden sind. Soth teilte einige dieser Stillies im Anschluss bei sich selbst auf Instagram und verwies auf sein Takeover. So hilft man sich gegenseitig mit Reichweite aus.
Die Währung auf Instagram sind Likes und Follower, es geht um Zahlen, um Reichweite, deswegen müssen Fotos performen, gut gehen und Herzchen, Herzchen, Herzchen sammeln. Viele Likes und viele Follower bedeuten viele Aufträge von Unternehmen, sprich gesponserte Beiträge auf dem eigenen Account, und dann müssen erst recht Bilder geliefert werden, die Likes bringen und den Followern Kommentare entlocken. „Wow!“, „Stunning!“, „Beautiful!“ – Instagrammer*innen mit gut bezahlten Aufträgen nennen sich nicht Fotograf*in, sondern Influencer, Visual Storyteller oder Content Creator.
Sie wissen genau, wie die Fotos aussehen müssen, welche Motive sie fotografieren müssen, damit ihre Follower klatschen. Kitsch geht immer, Sonnenuntergänge, Postkartenmotive sowieso, in den Großstädten sind es die Touristen-Hotspots, der Eifelturm, Big Ben, die Hamburger Speicherstadt, der Fernsehturm in Berlin oder generell Wendeltreppen und symmetrische Bildkompositionen. Atemberaubende Landschaftsaufnahmen sind aktuell das große Ding auf Instagram, immer im Bild wie schon bei Caspar David Friedrich der Mensch, ganz klein, den Mächten der Natur ausgeliefert.
Fragt man Stephen Shore, ob er schaut, wie viele Likes seine Bilder bekommen, sagt er ja. Und fügt gleich hinzu, dass er nicht sehr viele Likes bekommt. Shore hat inzwischen fast 80.000 Follower, im Schnitt hat er pro Foto 1.000 Likes. Im Vergleich dazu haben Landschaftsfotografen wie Maximilian Münch, der durch Instagram überhaupt erst zur Fotografie gekommen ist, 260.000 Follower und im Schnitt 15.000 Likes. Die Bilder sind gut nach den Maßstäben des sozialen Netzwerks und seiner Mitglieder, denen von Martin Parr dürften sie wohl eher nicht genügen.
Dieser Artikel erschien zuerst in der Photonews Ausgabe 11/2016. Für Interessierte gibt es hier weitere Artikel von Anika Meier zum Thema: